
Renate Welsh sitzt in einem dunkelroten Ohrensessel in der Ecke ihres hübschen Biedermeierzimmers in ihrer Wohnung im 7. Bezirk in Wien. "So, jetzt muss ich zum Zahnarzt", sagt die Autorin nach dem Interview. "Zum Zahnarzt, den Sie im Buch beschrieben haben?", frage ich. "Ja!" Welsh lacht. Den habe sie eh noch gut davonkommen lassen. Aufstehen, Stehen und Gehen fällt ihr immer noch schwer, aber sie ist unerschütterlich in ihrem Bemühen, weiterzumachen, das beweisen nicht zuletzt eineinhalb Stunden berührendes Gespräch mit ihr.
Standard: Wir haben einander bei einem Abendessen im Rahmen der Leipziger Buchmesse Ende April kennengelernt. Dieser Abend war für Sie nicht so erfreulich. Können Sie ein bisschen erzählen, warum das so war?
Renate Welsh: Da muss ich ausholen. Durch meinen Schlaganfall war ich eine, die plötzlich nicht mehr wusste, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Für mich war es sehr schwierig, dieses neue Buch zu schreiben, obwohl ich einen inneren Auftrag dazu verspürt habe. Meine Neurologin sagte, gerade eine wie ich, die von der Sprache kommt, sei doch geradezu beauftragt, diese Sprachlosigkeit zu schildern. Dazu kommt: Ich hatte mein Leben lang versucht, Sprachlosen eine Sprache zu geben, musste mir aber jetzt eingestehen, dass ich mir etwas vorgemacht hatte. Zwischen Verstehenwollen, sich selbst als Stellvertreterin zu sehen, und dem Eingesperrtsein in einen Käfig absoluter Sprachlosigkeit ist ein himmelweiter Unterschied. Es hat mein Verständnis von mir selbst ins Wanken gebracht. Ich war sehr verwundert, dass ich mit diesem Buch zumindest den Versuch einer Antwort für andere gefunden hatte, dass meine eigene Ratlosigkeit die anderer weniger ratlos gemacht hat. Und ich habe mich gefreut, dass Ich ohne Worte versprach, ein Erfolg zu werden. Aber um auf die Buchmesse in Leipzig zurückzukommen: Bei diesem Abendessen war ich wieder wie ausgelöscht, einfach nicht vorhanden neben wortführenden Männern, das habe ich schlecht vertragen. Nachher musste ich über mich lachen: Du denkst immer, du bist nicht eitel. Dabei bist du ganz schön eitel und hältst es schlecht aus, übersehen zu werden.
Standard: Ähnlich haben Sie es in Ihrem Buch beschrieben: dass Sie nach einem Schlaganfall leicht aus dem Takt zu bringen waren, dass Sie sich schnell entwertet und abgeschrieben fühlten. Wenn Sie heute, nach nicht einmal zwei Jahren, daran zurückdenken: Was war das vorherrschende Gefühl?
Welsh: Angst hatte ich ausschließlich um meinen Mann, der damals eine enorm schwierige Operation vor sich hatte. Ich selbst hatte keine Angst vor dem Sterben, aber in mir drin passierte eine ungeheuer anstrengende Gewissenserforschung, eine Art Zurückgehen in die Vergangenheit, in die Summe aller Versäumnisse, wenn man so will. Da kam niemand, der zu mir sagte: Ego te absolvo. Und natürlich habe ich mich schrecklich geschämt, dass ich so eine Last war. Aber selbst in Phasen heftigen Selbstmitleids konnte ich mich nicht darin suhlen. Ich habe mich selbst sehr lächerlich gefunden in meinem Elend.
Standard: Diese Ausgabe steht unter dem Thema "Weltflucht. Bitte Pause!" Bei Ihnen ist dieser Rückzug aus der Welt unfreiwillig passiert. Sie mussten in vielerlei Hinsicht Pausen einlegen. Hadern Sie heute damit, dass Ihnen das zugestoßen ist?
Welsh: Ja, schon. Dass ich immer noch so unrhythmisch gehe, ist etwas, das mich furchtbar ärgert. Gehen hat mir immer Freude bereitet. Unrhythmisches Gehen ist alles, nur nicht lustvoll. Ich kann oft auch schwer auseinanderhalten, was die Folgen des Schlaganfalls und was die des Alterns sind.
Standard: Sie beschreiben eindringlich, wie Sie durch den Schlaganfall in einen kleinkindähnlichen Zustand katapultiert wurden. Hat das bewirkt, dass Sie tatsächlich viel an Ihre Kindheit zurückdenken mussten?
Welsh: Ja, da gibt es sicher einen Zusammenhang. Du bist hilflos wie ein Säugling, da drängen sich solche Assoziationen auf. Umgekehrt liegt alles, was du dir irgendwann im Leben angelernt und angeeignet hast, in irgendwelchen Falten dieser seltsamen Nuss verborgen und ist als Potenzial vorhanden. Auch da, wo du glaubst, es herrsche nur noch Leere. Das Bedrohlichste, das es gibt, ist das Nichts. Aber das Nichts gibt es nicht. Irgendetwas, wenn auch unkenntlich verdreht, ist dann doch da.
Standard: Sie beginnen Ihr Buch mit diesem fulminanten Satz: "Als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei." Wie lange hat es gebraucht, bis so ein Satz dastand und Sie an diesem Buch arbeiten konnten?
Welsh: Meine linke Hand war fast vollständig gelähmt, und ich konnte zunächst auch mit der rechten nicht schreiben. Am zehnten Tag nach dem Schlaganfall bin ich mit der Rettung von Italien nach Wien überstellt worden. "Unvorstellbar, je wieder irgendwo anzukommen", heißt es darüber im Buch. Im Krankenhaus hatte ich meinen Laptop zur Verfügung, konnte aber nicht mehr schreiben. Das war sehr frustrierend. Ich war sehr wütend, habe es aber immer wieder probiert. Nach unendlich vielen Versuchen stand irgendwann ein Satz da. Auf den war ich dann sehr stolz.
Standard: Wie schnell wurde Ihnen klar, dass Sie das alles aufschreiben werden?
Welsh: Schnell. Es gab diese unglaublich gute Logopädin, die mich in allem sehr bestärkt hat. Sie hat beschlossen, dass ich nach einer Woche im AKH eine Lesung aus Die alte Johanna machen soll. Das war für mich eine Erfahrung, durch die mir klar wurde, wie weit Menschen über das, was man von ihnen erwarten kann, hinausgehen können. Ich hatte beim Sprechen ungeheure Schwierigkeiten, aber Lesen, das ging irgendwie.
Standard: "Ich ohne Worte" ist ein Titel, der schon alles sagt. Wer waren Sie, die Schriftstellerin, in dieser Zeit ohne Worte?
Welsh: Zuerst war ich wirklich niemand. Es ist nichts geblieben. Da war nicht nur dieses Bein, das nicht mir gehörte, das ich fortschmeißen wollte. Ich als Ganzes war nichts mehr. Deswegen waren die ständigen Überforderungen meiner Logopädin auch so hilfreich. Jeder braucht etwas, worauf er stolz sein kann. Bei mir war das meine Sprechstimme. Du kannst so schön lesen, haben alle immer gesagt. Das, worauf ich Wert gelegt hatte, war mir verloren gegangen. Deswegen war ich auch so dankbar, wenn jemand zu diesem Nichts so freundlich war.
Standard: Sie schreiben darüber, wie schwer es in einer Situation der Hilflosigkeit ist, Hilfe anzunehmen.
Welsh: Es ist zum Teil eine andere Art des Schauens. Du siehst ja nicht viel. Der Neurologe und Schriftsteller Oliver Sacks hat das nach seinem Unfall in "Alles an seinem Platz" anschaulich beschrieben, wie er in einem engen Krankenzimmer lag und monatelang nach seiner Überführung in ein weit größeres Zimmer nur sehen konnte, was innerhalb dieses engen Gesichtsfeldes lag. Alles, was weiter entfernt war, hat nicht mehr existiert. Was aber unmittelbar vor dir ist, das siehst und erlebst du viel klarer. Und dieses deutlichere Erleben führt dazu, dass etwas Neues entstehen kann. Diesen reduzierten Radius gehst du aus, immer wieder. Den Riss in der Wand erlebst du deutlich. Die Art, wie dich jemand anschaut, wird zu einer echten Erfahrung. Daran lässt sich aufbauen.
Standard: Kann man sagen, dass dieses Buch ein Dankeschön ist an die Menschen, die für Sie da waren?
Welsh: Genau das ist es. Das Bedürfnis zu danken kann sein wie Hunger und Durst.
Standard: Sie haben immer wieder erzählt, dass Sie sich lange nicht alt gefühlt hätten.
Welsh: Ich konnte mich nie einordnen, habe mich nicht wirklich zugehörig gefühlt, nicht zu einer Gesellschaftsschicht und nicht zu einer Altersgruppe. Die Dinge, die für mich wichtig waren, hatten nichts mit Alter oder Herkunft zu tun.
Standard: Sie leben in Wien und auch auf dem Land in der Nähe von Gloggnitz. Apropos Weltflucht: Was gibt Ihnen das Land?
Welsh: Wir sind mit unseren Nachbarn sehr verbunden, und es gibt dort auch viele Erinnerungen an die Kinder, als sie klein waren. Mein Vater hat das Haus in verwahrlostem Zustand gekauft und zu uns gesagt: Macht was draus! Er wollte, dass seine Enkelkinder nicht nur als neurotische Stadtkinder aufwachsen. Familienfeste und Ferien sind mit dem Land verbunden, ich glaube, mein Mann fühlt sich da am meisten zu Hause, wo er kräftig gebuddelt und gestaltet hat. Manchmal habe ich Sehnsucht nach dem Loser und dem Altausseer See, wo die Erinnerungen an meine Mutter zu Hause sind. Ich bin gern auf dem Land, aber auch sehr gern wieder in der Stadt.
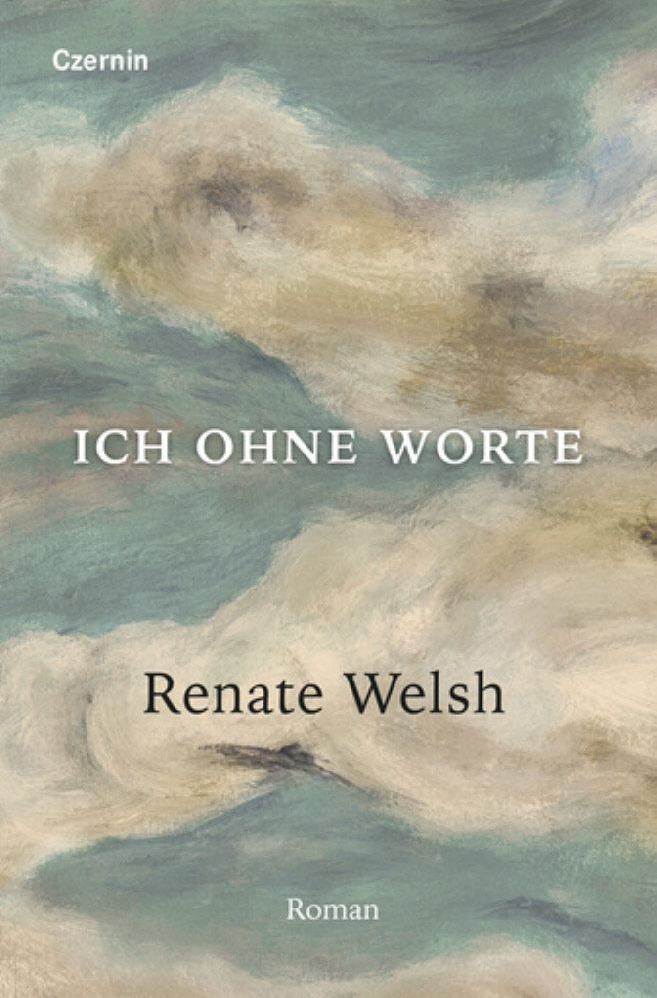
Standard: Haben Sie sich das Altsein so vorgestellt?
Welsh: Ich bin noch nicht so weit, ich kann es nicht sagen. Ich finde es sehr angenehm, dass ich jetzt in der U-Bahn einen Sitzplatz angeboten bekomme, weil Stehen für mich immer noch sehr schwierig ist, mich schwindelig macht. Rücksicht zu nehmen auf meine körperlichen Befindlichkeiten, das muss ich noch lernen. Ich möchte nicht ausschließlich als alt wahrgenommen werden.
Standard: Schrifstellerinnen wie Sie gehen in der Regeln nicht in Pension.
Welsh: Ganz abgesehen davon, dass mir auch keiner eine Pension zahlt. Als die Möglichkeit einer Pension für Schriftstellerinnen geschaffen wurde, war ich grad um das berühmte "Ernzerl" zu alt. Ich habe das, was ich mir erspart habe, aber keinen Groschen Pension. Ich sitze weiter an meinem Laptop und schreibe, aber das täte ich gewiss auch, wenn ich eine Pension bekäme. Ich weiß wirklich nicht, wie ich ohne Arbeit mit den äußeren und inneren Widersprüchen zurechtkäme. Das ist vielleicht eine Bankrotterklärung, aber so ist es.
Standard: Jetzt kommt der Sommer. Haben Sie je daran gedacht, nochmal auf die Fischerinsel in Italien, wo der Unfall passiert ist, zurückzukehren?
Welsh: Ich hatte neulich panische Angst, eine abergläubische, blöde Angst vor einem Abendessen mit den Menschen, die damals in Italien dabei waren, nur wegen der Gruppenzusammenstellung. Das mit der Fischerinsel habe ich aber tatsächlich überlegt. Sie muss ja sehr schön sein, noch habe ich so gut wie nichts von ihr gesehen. (Mia Eidlhuber, 28.5.2023)