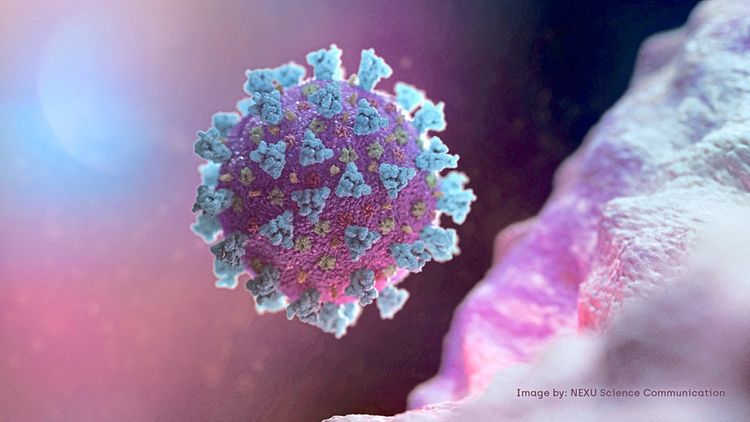
Einer Viruserkrankung ist medizinisch oft schwer beizukommen. Anders als bei Infektionen durch Bakterien, die man mit Antibiotika meist gut behandeln kann, hat man gegen Erkrankungen durch Viren keine so potenten Mittel zur Hand. Vor allem keines, das universell einsetzbar ist. Das hat man auch in der Pandemie schwer zu spüren bekommen. Umso wichtiger war die Entwicklung von Medikamenten, die in den Mechanismus der Virusvermehrung eingreifen. Eines der ersten entsprechenden Medikamente, die zur Verfügung standen, war Molnupirarvir vom Pharmaunternehmen Merck. Weitere Medikamente sind Remdesivir, das ein ähnliches Prinzip verfolgt, und Paxlovid aus dem Haus Pfizer, das einen etwas anderen Wirkmechanismus hat.
Molnupiravir war dabei in seiner Wirkung von Anfang an umstritten. Zur Verfügung stand es ab Jänner 2022 im Zuge eines sogenannten Compassionate-Use-Programms, erklärt Markus Zeitlinger, Klinischer Pharmakologe an der Med-Uni Wien. "Das bedeutet, das Medikament konnte mit Zustimmung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eingesetzt werden, obwohl der offizielle Zulassungsprozess noch nicht abgeschlossen war. Einreichungsprozess und Einsatz bei Erkrankten sind parallel gelaufen." Auch das Covid-Medikament Paxlovid wurde unter diesen Voraussetzungen in den Markt eingeführt.
Tatsächlich waren die Studiendaten zur Wirksamkeit von Molnupiravir von Beginn an wenig stabil, im Winter 2022/23 erstellte die EMA einen negativen Bescheid für die Zulassung, da es nicht ausreichend wirksam sei. So hat etwa eine Studie, die im Dezember 2022 im Fachjournal The Lancet erschienen ist, festgestellt, dass Molnupiravir weder die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten noch jene von Todesfällen unter Hochrisiko-Erkrankten verringert. Anfang des Sommers hat der Entwickler Merck das Medikament zurückgezogen – obwohl man den Bescheid beeinspruchen hätte können.
Mutation als Tötungsstrategie
Doch es kommt noch dicker. Eine diese Woche im Fachjournal Nature veröffentlichte Studie legt nahe, dass das antivirale Medikament bestimmte Mutationen bei Sars-CoV-2 hervorrufen kann. Das liegt am Wirkmechanismus von Molnupiravir. Dieser ist nämlich so, dass er bei der Replikation des Virus Mutationen in dessen Genom bewirkt. Das Prinzip ist, dass die vielen Mutationen schädlich sind für das Virus und schlussendlich die Replikation komplett unterbinden. Durch diese Molnupiravir-induzierten erhöhten Mutationsraten wird die Viruslast verringert. Doch hier hat sich nun ein Problem aufgetan: Wenn bei Patientinnen und Patienten, die mit Molnupiravir behandelt wurden, Sars-CoV-2-Infektionen nicht vollständig heilen, besteht eventuell die Möglichkeit einer Weiterübertragung von Molnupiravir-mutierten Viren.
"Molnupiravir soll die Viruslast im Körper durch diesen angeregten Mutationsvorgang innerhalb von 24 Stunden massiv reduzieren, den Rest erledigt dann das Immunsystem. Das funktioniert auch, wenn das Immunsystem gut arbeitet. Bei Personen mit schlechter oder reduzierter Immunantwort kann es aber passieren, dass das Virus nicht komplett eradiziert, also ausgelöscht wird", erklärt Zeitlinger. Das ist übrigens ein ganz ähnlicher Vorgang, nach dem auch, allgemein anerkannten Theorien zufolge, jene Mutationen entstanden sein sollen, die sich weltweit durchgesetzt haben, etwa Omikron. Man geht davon aus, dass das Virus in einer immunsupprimierten Person über viele Monate chronisch fortbestanden hat und so jene Mutationen ausbilden konnte, die ihm den entscheidenden "Wettbewerbsvorteil" gegenüber der bis dahin vorherrschenden Delta-Variante verschafften.
Dass diese Gefahr bei Molnupiravir besteht, hat man von Anfang an gewusst. Tatsächlich ging die Abstimmung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für einen Compassionate Use nur äußerst knapp für das Medikament aus. Die jetzt vorliegende Studie konnte diesen Vorgang nun auch genetisch nachweisen. Denn man konnte in Proben eine Mutationssignatur erkennen, die mit dem Einsatz von Molnupiravir korrespondiert. So wurde in Ländern, in denen das Mittel häufiger eingesetzt wurde, wie Großbritannien, Australien, Japan oder den USA, ähnliche Mutationen bis zu achtmal häufiger gefunden. "Da ist ein bestimmtes Muster entstanden, eine Art Fingerabdruck", sagt der Experte. In Ländern wie Kanada, wo das Medikament nicht eingesetzt wurde, wurden diese Mutationen deutlich seltener gefunden.
Keine besondere Gefahr
Was bedeutet das nun konkret? Es sei schwer zu sagen, ob Molnupiravir den Verlauf der Variantengenerierung oder -übertragung verändern könne, stellen die Autorinnen und Autoren der Studie fest. Und auch Zeitlinger betont: "Man weiß strenggenommen nicht genau, was das bedeutet und ob es überhaupt relevant ist. Grundsätzlich konnten diese Mutationen unter bestimmten Voraussetzungen das Spike-Protein verändern, diese haben zum Teil ähnlich ausgesehen wie jene, die die Weltgesundheitsorganisation als 'Varianten unter Beobachtung' eingestuft hat."
Manche Viren mit den Mutationen konnten auch tatsächlich auf andere Menschen übertragen werden. "Das war es dann aber. Ein Supervirus ist dadurch nicht entstanden, und mittlerweile ist das Medikament auch nicht mehr im Einsatz. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit hat das Medikament klinisch einfach keine ausreichende Wirkung gehabt", schätzt Zeitlinger die Lage ein.
Die Studie findet er deshalb wichtig, weil sie nachweisen konnte, dass das Medikament einen Selektionsdruck erzeugt: "Diese Erkenntnis kann man für weitere Forschung nutzen und in Zukunft bei ähnlichen Medikamentenentwicklungen auf diesen Mechanismus Rücksicht nehmen." (Pia Kruckenhauser, 26.9.2023)