
Wie wir lieben, wie wir streiten, wie wir uns verändern können und wie wir Zufriedenheit erlangen – das sind die großen Themen, die uns im Leben bewegen. Schafft man es, seine Beziehungen auf ein gutes Fundament zu stellen, lassen sich auch andere Probleme, über die man im Leben stolpert, besser bewältigen. Zumindest ist Philippa Perry davon überzeugt.
Die Psychotherapeutin versucht in ihrer Zeitungskolumne "Ask Philippa" jeden Sonntag im Guardian Fragen zu beantworten wie: Wie findet man die Liebe und hält sie fest? Wie kann man Konflikte bewältigen? Wie schafft man es, mit Veränderung und Verlusten umzugehen? Nerven die anderen, oder sind wir selbst das Problem? Sie ist so etwas wie die Kummertante der britischen Nation.
Um diese Fragen dreht sich auch ihr Werk Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen. Im STANDARD-Interview spricht Perry über den Voyeurismus in Psycho-Kolumnen und darüber, wie Beziehungsmuster überhaupt entstehen und warum man dem Partner nicht die Lieblingspralinen wegessen soll.
STANDARD: Sie sind sozusagen die Kummertante der britischen Nation. Für Ihre Kolumnen brechen Sie komplexe Probleme auf relativ kurze Antworten herunter. Sind so kurze Ratschläge nicht etwas oberflächlich? Da geht es ja um therapeutische Inhalte, die wesentlich tiefgreifender sind ...
Perry: Ich hoffe nicht, dass ich oberflächlich bin. (lacht) Tatsache ist, dass die Menschen diese Kolumnen geradezu verschlingen, sie gehören zu den meistgelesenen Seiten der Zeitung. Es stimmt, die Fragen drehen sich jeweils um ein spezifisches Problem. Aber die Antworten, die ich gebe, haben ein breiteren Zugang, ich versuche, so viel von meinem psychotherapeutischen Wissen weiterzugeben wie möglich. Sie laden ein, hinter die Kulissen zu schauen und das Thema auf der nächsten Ebene zu analysieren. Insofern können sich viele Menschen etwas mitnehmen, denke ich.
Und die Kolumne hat natürlich in gewisser Hinsicht auch einen voyeuristischen Effekt. Viele Menschen denken gerne über die Probleme anderer Leute nach, egal ob es sich dabei um die Frage handelt, wie man seinen Mann verlässt, wie man einen Streit mit der Schwester klärt oder wie man die eigene Beziehung wieder kittet. Dann überlegen sie sich, wie sie diese gelöst hätten, und nicht wenige schreiben das in das Forum unter der Kolumne. Diese Lösungen sind oft ganz anders als meine Zugänge. Auf jeden Fall animiert die Kolumne die Menschen dazu, sich Gedanken über diese Probleme zu machen.
STANDARD: Bei all diesen Fragestellungen geht es um Beziehungen. Aber warum bergen Beziehungen eigentlich so viel Konfliktpotenzial?
Perry: Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht sehr anspruchsvoll sind. Oder wir sind zu anspruchsvoll. Das kommt auf die Perspektive an. Die Art, wie wir in unserem Leben Verbindungen aufbauen, ist sehr häufig davon beeinflusst, wie wir in der Vergangenheit geliebt wurden. Wir suchen uns Partnerinnen und Partner, die mit ihrer Art, einen zu lieben, in uns die gleichen Gefühle auslösen wie jene Menschen, die uns großgezogen haben. Das ist uns vertraut und fühlt sich richtig an. Diese Bindungsmuster entwickeln sich schon in der ganz frühen Kindheit.
Viele Menschen haben Liebe und Zuneigung aber nicht als bedingungslos erlebt. Man hat vielleicht die Erfahrung gemacht, dass man nicht getröstet wird, weil die Eltern nicht immer greifbar waren, dass man dann auf sich allein gestellt ist. Oder man hat sich gegen andere, Geschwister zum Beispiel, verteidigen oder durchsetzen müssen. Das Problem ist, dass man in dem Alter kein Referenzsystem hat, man kann diese Erfahrungen nicht einordnen. Man reagiert einfach und lernt aus Erfahrung, mit welchem Verhalten man die ersehnte Aufmerksamkeit bekommt. Daraus können sich dann langfristig Beziehungsmuster entwickeln, die auch im Erwachsenenalter noch bestehen. Und wenn die nicht positiv sind, können sie in der eigenen Beziehung zu Problemen führen.

STANDARD: Kann man gegen solche schwierigen Bindungsmuster etwas unternehmen?
Perry: Ja, indem man versucht, aus dem eigenen Muster auszusteigen. Ich gebe Ihnen ein Streitbeispiel, da geht es im Grunde ja oft um ganz banale Dinge, und dabei kommen sehr ursprüngliche Gefühle zum Vorschein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Schachtel Pralinen bekommen. Sie öffnen diese und freuen sich auf Ihre Lieblingssorte. Und dann stellen Sie fest, dass genau die schon herausschnabuliert wurde. Man wirft dann dem Gegenüber fast schon automatisch vor: "Du hast meine Pralinen gegessen." Das Gegenüber sieht das aber anders und sagt: "Stimmt doch nicht, die waren für uns beide. Und es sind ja eh noch welche da." Dann entwickelt sich womöglich ein ausgewachsener Streit, wem jetzt die Schokolade gehört hat, und es gipfelt in dem Vorwurf, dass sich die andere Person immer die Dinge unter den Nagel reißt, die ihr eigentlich nicht zustehen.
Aber was steckt da wirklich dahinter? Ein sehr basales Gefühl, man fühlt sich, mit all den Bedürfnissen, die man hat, nicht gesehen. Wenn der eigene Anspruch auf die Pralinen nicht anerkannt wird, dann wird man sozusagen als Person nicht anerkannt. Und man hört in gewisser Weise auf zu existieren.
STANDARD: Ist dieser Rückschluss nicht recht weit hergeholt?
Perry: Nein, keinesfalls. Denken Sie einmal darüber nach, über welche fast schon Lächerlichkeiten man streiten kann. Wir wissen, dass wir existieren, durch die Tatsache, wie uns andere Menschen wahrnehmen und spiegeln. Werden unsere Bedürfnisse in dieser Spiegelung nicht anerkannt, trübt das auch das eigene Bild, es kann schwierig werden in einer Beziehung.
STANDARD: Aber wie steigt man aus so einer Dynamik aus?
Perry: Indem man sich dieser Hintergründe bewusst wird und die Sichtweise des Gegenübers zu verstehen versucht. Die Schuldzuweisung, dass die andere Person einem die Pralinen weggegessen hat, bringt niemanden weiter. Wenn man stattdessen versucht anzuerkennen, dass die andere Person von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, nimmt das viel heiße Luft aus einem Streit heraus. Es geht ja beim Streiten nicht um einen Gewinner. Es geht darum, Verständnis füreinander aufzubringen und die unterschiedlichen Sichtweisen zu klären. Damit erkennt man auch die gegenseitigen Bedürfnisse an.
STANDARD: Klingt eigentlich recht einfach ...
Perry: Ja und nein. Theoretisch ja, praktisch wollen viele in einem Streit einfach gewinnen, sich durchsetzen, das ist ja auch etwas ganz Natürliches. Und aus den eigenen Schuhen raussteigen, die Perspektive des Gegenübers einnehmen, das erfordert auch Übung.
STANDARD: Streit gibt es in fast jeder Beziehung irgendwann, auch über Kleinigkeiten. Aber wie erkennt man, wenn der Streit zu viel wird? Dass einem diese Beziehung nicht mehr guttut?
Perry: Die große Frage ist, wie man sich mit dieser Person fühlt. Fühlt man sich vorwiegend gut, wenn man mit ihr zusammen ist? Oder fühlt man sich unsicher, ständig unter Beobachtung oder womöglich minderwertig und ängstlich? Dann sollte man wirklich ehrlich mit sich selbst sein und nicht bei einer Person bleiben, die einem nicht überwiegend ein gutes Gefühl vermittelt. Das gilt übrigens nicht nur für Beziehungen, sondern auch für Freundschaften.
STANDARD: Viele haben aber die Hoffnung, die andere Person werde sich ändern, wenn man nur lange genug ausharrt. Ist dieser Wunsch realistisch?
Perry: Eher nicht. Man kann eine andere Person nicht ändern, indem man die eigenen Handlungen und Verhaltensweisen an die Erwartungen des Gegenübers anpasst. Menschen ändern sich nur, wenn sie das selbst auch wirklich wollen und die eigenen Muster hinterfragen. Zeigt die andere Person diesbezüglich kein Engagement, kann es aber helfen, sich mit den eigenen Mustern auseinandersetzen. Dann stellt man womöglich fest, dass der Partner oder die Partnerin emotional ähnlich tickt wie ein Elternteil und man deshalb die negativen emotionalen Muster aus der Kindheit wiederholt.
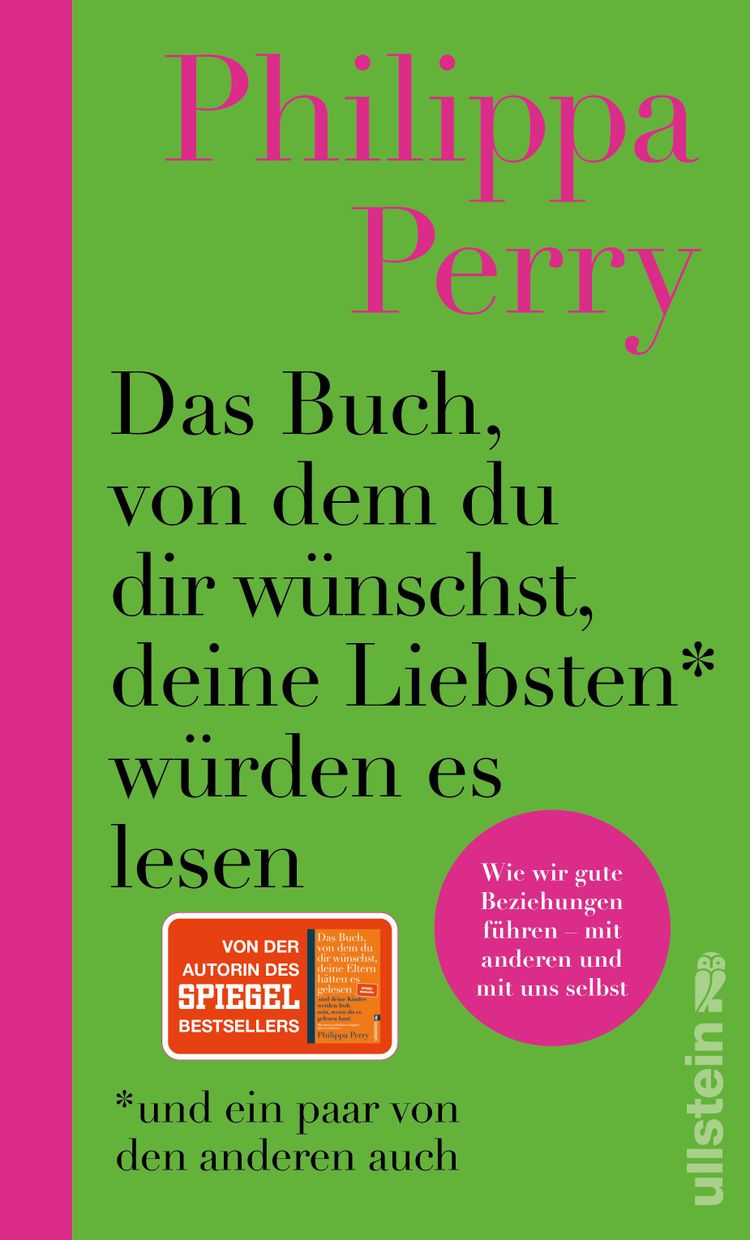
STANDARD: Und was verändert das?
Perry: Man merkt womöglich, dass man beim falschen Typ Mensch das Glück sucht. Vielleicht hatte man immer das Gefühl, man suche nach einer dynamischen Person, die erfolgreich ist, womöglich ein wenig verrucht, und immer den Ton angibt, weil man das selbst so vorgelebt bekommen hat als Beziehungskonzept. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Dynamiken zeigt dann womöglich auf, dass ein ruhiger, entspannter Mensch, der eher im Hintergrund bleibt und einem den Rücken freihält, viel eher die eigenen Bedürfnisse erfüllt. Man stellt fest, dass der eigene Typ gar nicht der eigene Typ ist. Und das kann einiges aufbrechen.
STANDARD: Zum Beispiel?
Perry: Man versteht womöglich, dass Liebe nicht dieser Blitz ist, der einen aus heiterem Himmel trifft. Ja, das gibt es, aber das ist erotische Anziehungskraft und im Grunde Chemie. Das bedeutet nicht, dass man nach so einem Blitzschlag keine gute und langfristig stabile Beziehung aufbauen kann. Aber es ist keineswegs gewiss, im Gegenteil. Diese Liebe auf den ersten Blick schürt sehr hohe Erwartungen, die oft nicht erfüllt werden können. Beginnt eine Liebe dagegen langsam, kann man sie lange und stabil aufbauen.
STANDARD: Es ist halt diese Liebe auf den ersten Blick, dieser Blitzschlag, der uns in praktisch jedem romantischen Film präsentiert wird ...
Perry: Das stimmt. Es ist nun einmal keine sehr aufregende Geschichte, wenn sich ein Mann und eine Frau kennenlernen, und ihre Liebe wird langsam, aber stetig immer tiefer. Spannend wäre es, bei dem Blitzschlag-Paar ein paar Jahre später noch einmal hinzuschauen. Wenn die Beziehung immer noch besteht, wird sie sich verändert haben. Da ist dann viel Beziehungsarbeit passiert, auch wenn einem das vielleicht gar nicht bewusst ist.
Ich finde es auch schwierig, dass in Filmen und Serien so ein romantisches Bild vermittelt wird. In England gibt es eine Serie, Avoidance, die damit beginnt, dass sich eine Frau von ihrem Mann trennt. Anstatt das irgendwann zu akzeptieren, versucht er jedes Mittel, damit sie wieder zu ihm zurückkommt. Das macht mich wirklich wütend. Diese Serie vermittelt, man müsse es nur immer und immer wieder probieren, dann sagt die Frau irgendwann Ja. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil es im Grunde eine Ermutigung ist für Männer, Frauen nicht in Ruhe zu lassen, sie richtiggehend zu belästigen.
STANDARD: Das klingt so, als würde der Mann in der Serie nicht mit Veränderung umgehen können. Aber Veränderung, gewollt oder ungewollt, passiert doch ständig in unserem Leben. Warum tun wir uns damit so schwer?
Perry: Das versteht man womöglich leichter, wenn man auf einem sehr basalen Niveau über Veränderung nachdenkt. Man liegt in der Früh im Bett, der Wecker hat geklingelt, und man weiß, man muss aufstehen. Aber man will nicht aufstehen, es ist so gemütlich im Bett, und man ist doch noch müde. Man muss sich überwinden, womöglich ein bisschen anstrengen, damit man in die Gänge kommt. Das Gleiche passiert am Abend, wenn man weiß, es wäre gut, sich jetzt hinzulegen. Aber irgendwie kann man sich nicht dazu aufraffen, auch wenn man schon wirklich müde ist.
Und nichts anderes passiert auf einer höheren Ebene. Für Veränderung braucht man immer eine gewisse Anstrengung, man muss sich aus der eigenen Komfortzone hinausbewegen, das Unbekannte hereinlassen. Deshalb bleiben auch viele Menschen so lange in Beziehungen, die sie eigentlich nicht mehr glücklich machen.
STANDARD: Warum steigen sie irgendwann aber doch aus?
Perry: Weil es sich irgendwann wirklich ungemütlich anfühlt. Dann sucht man lieber die Veränderung, als noch länger dieses zermürbende Gefühl zu ertragen. Aber es ist anstrengend, weil jede Veränderung – und das Ende einer Beziehung, egal ob gewollt oder ungewollt, ist eine große Veränderung – einen leeren Raum in uns zurücklässt, in dem davor das Vertraute war. Diesen leeren Raum müssen wir wieder füllen.
STANDARD: Das heißt, Veränderung ist wirklich wichtig?
Perry: Ja, sonst verbaut man sich den Weg zur eigenen Erfüllung. Das geht womöglich nicht immer gleich gut, auch deshalb schrecken so manche vor Veränderung zurück. Sie haben Angst vor dem Scheitern. Aber Scheitern bedeutet nur, dass man etwas ausprobiert hat. Und nur wenn man Neues ausprobiert, kann man auch persönlich wachsen und sich entwickeln. (Pia Kruckenhauser, 25.5.2024)