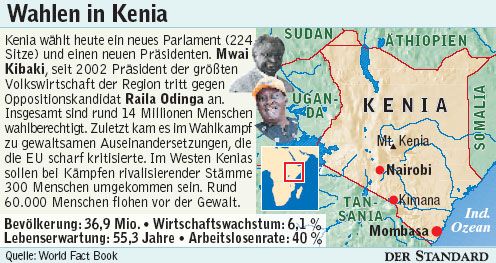Die 30-Jährige will nicht länger warten, dass jemand anderes sie und ihre Altersgenossen vertritt. „Bei uns regiert immer noch die Gründergeneration. Präsident Mwai Kibaki hat noch den Unabhängigkeitsvertrag von Großbritannien ausgehandelt.“ Das habe mit Traditionen zu tun, in Kenia habe das Wort der Älteren schon immer besonderes Gewicht gehabt.
Auch in Owokos Wahlkreis Buru Buru sind unter den 25 Kandidaten viele Vertreter der alten Garde. „Der Amtsinhaber ist Ruben Dollo, ein ehemaliger Box-Champion“, rümpft Owoko die Nase. Ein System von Paten statt Politikern habe Kenia, kritisiert Owoko – wer gewählt wird, versorgt seine Anhänger mit dem neu erworbenen Reichtum. In keinem Entwicklungsland werden Abgeordnete besser bezahlt als in Kenia. Um ein Mandat zu bekommen, gibt es daher kaum Hemmungen. Dollo etwa hat für diese Wahl die Parteien gewechselt - vor fünf Jahren kandidierte er noch für die Regenbogenkoalition von Kibaki. Jetzt versucht er sein Glück auf dem Ticket des oppositionellen „Orange Democratic Movement“ (ODM) – so genannt, weil die Wahlkommission der Bewegung eine Orange als Symbol verpasste. In den Umfragen liegt ODM-Chef Raila Odinga knapp vor Präsident Kibaki.
Wendehälse wie Dollo gibt es viele, weil die Jungen und die Slumbewohner vom Wirtschaftsaufschwung nichts abbekommen haben. „Wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin und mit Wählern rede, dann sollte ich sie theoretisch mit meinen Ideen begeistern können – aber viele wollen vor allem eins wissen: Wie viel Geld gibst du mir?“, erzählt Owoko. Gerade in den Slums von Buru Buru ist es normal, dass ein Kandidat seinen potenziellen Wählern nach einer Rede ein paar Scheine zusteckt. „So was kann ich mir einfach nicht leisten.“ Den Ärmsten nimmt Owoko nicht übel, dass sie sich kaufen lassen. „Aber es zeigt, wie tief wir gesunken sind.“ Sie wirbt für einen konsultativen Führungsstil, bei dem die Abgeordneten sich mit ihrem Wahlkreis laufend rückkoppeln; für die Auflage eines Jugendfonds, die Förderung junger Sporttalente und eine bessere Gesundheitsvorsorge für Frauen. „Das ist vielleicht manchmal ein bisschen viel Theorie für Leute, die morgens nicht wissen, ob sie abends etwas zu essen haben werden“, gesteht sie ein.
In einem Wahlkampf, der wie kaum einer zuvor durch ethnische Abgrenzungen geprägt ist, setzt auch sie auf ihre Herkunft. „Ich bin ethnische Luo, und wir stellen in meinem Wahlkreis die zweitgrößte Gruppe nach den Kikuyu.“ Ihr Selbstbewusstsein geht nicht so weit, dass sie auch Angehörige anderer Ethnien überzeugen will. „Ich rede nur mit den Luo und ein paar kleinen Ethnien, alles andere wäre Zeitverschwendung.“