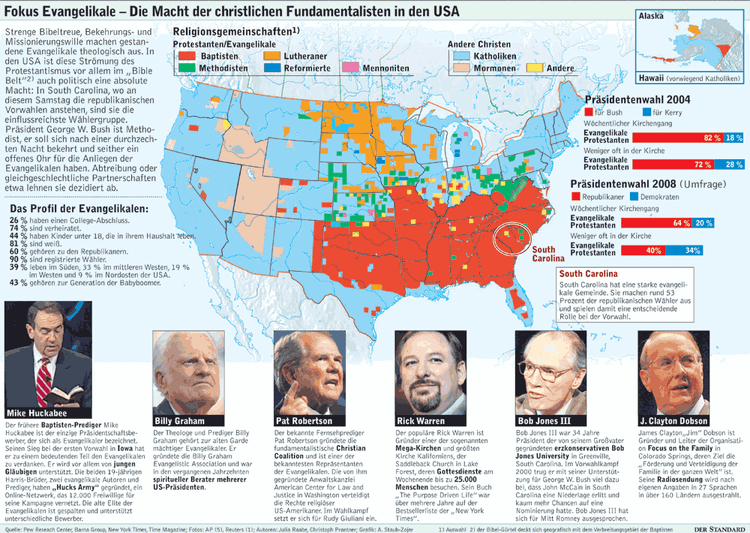„Ich habe Gegner in diesem Rennen, die wollen die Verfassung nicht ändern. Ich glaube, dass es viel einfacher ist, statt des Wortes Gottes die Verfassung zu ändern. Und genau das ist es, was wir tun müssen. Die Verfassung so ändern, dass sie Gottes Standard entspricht.“
So weit hat sich Mike Huckabee noch nie aus dem Fenster gehängt. Meistens, wenn der Ex-Prediger im Wahlkampf für die Religion warb, zitierte er eben auch den Ersten Verfassungszusatz, der vorschreibt, Staat und Kirche zu trennen. So offensiv wie jetzt klang er noch nie. Und noch nie hat er seinen Anhängern so unverblümt das Besondere seiner Bewerbung erklärt. „Lange hat man uns Leute des Glaubens gebeten, die Kandidaten zu unterstützen, die mit uns reden, die zu uns kommen. Aber selten gab es einen, der von uns kommt, aus unseren Reihen.“
Dass Huckabee ausgerechnet jetzt Klartext redet, ist sicher kein Zufall. Er will sich seinen Republikanern in South Carolina empfehlen, ein Sprungbrett schaffen. Die dortige Vorwahl ist die erste im frommen, konservativen „Bibel-Gürtel“ des Südens, dort werden Weichen gestellt. In dem Bundesstaat zwischen den Appalachen und dem alten Sklavenhafen Charleston wird meist recht zuverlässig getestet, wem die evangelikalen Protestanten landesweit den Zuschlag geben.
2000 und 2004 ebneten sie George W. Bush den Weg ins Weiße Haus. Beim ersten Mal bekam Bush 72, beim zweiten Mal 82 Prozent der evangelikalen Stimmen. Huckabee ist der Mann, der hofft, diese Goldader für sich auszubeuten.
Logisch wäre es, ist er doch geprüfter Prediger der Southern Baptist Convention, der größten protestantischen Einzelkirche der USA. John McCain, einer seiner schärfsten Widersacher, hat sich im Jahr 2000 gründlich mit den Religiösen verkracht. Angewidert über die Art, wie sie ihn persönlich angriffen, wilde Gerüchte über Seitensprünge und uneheliche Kinder in die Welt setzten, beschimpfte er zwei von ihnen, Pat Robertson und Jerry Falwell, als „Agenten der Intoleranz“.
„Sektierer“ Romney
Mitt Romney, der Mormone, kann seine tadellose Familie noch so oft vorzeigen, eine Ehefrau, mit der er seit High-School-Tagen verbandelt ist, fünf wohlgeratene Söhne – das Misstrauen kann er nicht bannen. „Niemand gibt das offen zu, aber natürlich, es ist ein Problem“, sagt der Reverend Hershael York, Theologe am Southern Baptist Seminary in Louisville, Kentucky. „Evangelikale sehen Mormonen als Sekte. Es ist ihnen unbehaglich, Romney die Stimme zu geben.“
Dennoch, manches ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. York weiß, worauf es den Kirchenleuten vor allem ankommt: „Sie wollen jemanden, der ihnen die Türen zum Weißen Haus öffnet“. Wenn dieser Jemand einer von ihnen sei, umso besser. Entscheidend sei das aber nicht. Wichtiger sei der Zugang zur Macht. Der Glaube, dass das Pferd, auf dass man setze, bis zum Schluss im Rennen bleibe. „Electability“ (Wählbarkeit) ist das wichtigste Kriterium.
Das erklärt, warum der Fernsehprediger Pat Robertson auf Rudy Giuliani baut, genauer gesagt, sich zu einer Zeit auf Giuliani festlegte, als die Favoriten über den witzigen, aber vermeintlich chancenlosen Huckabee noch lächeln konnten. Robertson traut beziehungsweise traute dem New Yorker am ehesten zu, zu gewinnen. Dafür nahm er in Kauf, dass der Mann zum dritten Mal verheiratet ist, in Frauenkleidern bei _einem Kostümball erschien, die Schwulenehe toleriert – alles Frevel für einen konservativen Pfarrer. Das Stichwort „Wählbarkeit“ erklärt auch, warum sich einige der einflussreichsten Evangelikalen auffällig zurückhalten, wenn es darum geht, einen Favoriten zu bestimmen. Erst wollen sie sehen, wie die Würfel ungefähr fallen könnten. Zudem gibt es so etwas wie einen Generationenkonflikt, und der erklärt, wieso jüngere Pastoren ihre Fühler durchaus auch zu den Demokraten ausstrecken.
In die Kirche geladen
Rick Warren etwa, Gründer der kalifornischen Saddleback Church, einer Kathedrale, die 80.000 Eingeschriebene zählt. Mit seinem Buch „The Purpose Driven Life“, was so viel bedeutet wie „Das von Sinn geleitete Leben“, schrieb er einen Bestseller, der 25 Millionen Mal verkauft wurde. Im November bat Warren alle führenden Präsidentschaftsanwärter in seine Kirche, um ihre Gedanken zum Kampf gegen Aids darzulegen. Die Einzige, die persönlich erschien, war Hillary Clinton.
Ron Carpenter (39), Pastor einer Megakirche in Greenville, South Carolina, hat Barack Obama als „überaus netten Mann“ kennengelernt. Carpenter lud den schwarzen Senator ein, beim sonntäglichen Gottesdienst ein paar Worte zu sagen. Zum einen ging es ihm um das Versöhnungssignal, gerade im Süden mit seiner langen Vorgeschichte der Rassenschranken. Zum anderen macht Apostel Ron, wie er sich nennt, im Interview sehr deutlich klar, dass er politischen Spielraum sucht.