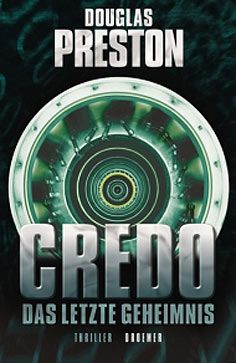
Douglas Preston: "Credo. Das letzte Geheimnis"
Gebundene Ausgabe, 586 Seiten, € 17,50, Droemer/Knaur 2008.
Vor ein paar Tagen ist der Large Hadron Collider von CERN in den Testbetrieb gegangen: Ein reales Ereignis, das seine literarischen Schatten vorausgeworfen hat. In einer früheren Rundschau wurde bereits Robert Sawyers "Flash" rezensiert, nun ist der aktuelle Roman von Bestseller-Lieferant Douglas Preston an der Reihe. Und gleich die augenfälligsten Unterschiede sind bezeichnend: Während der Kanadier Sawyer seinen Roman am Schweizer CERN-Gelände mit internationaler Crew spielen lässt, wählt US-Autor Preston den fiktiven Teilchenbeschleuniger "Isabella" in Arizona als Schauplatz für das wichtigste Experiment in der Geschichte der Physik ... vielleicht um die Perspektive "richtig" zu rücken. Immerhin soll mit "Isabella" die amerikanische Führung in der Teilchenphysik (ähem) gewahrt bleiben und alle Hauptfiguren sind US-AmerikanerInnen. Zweitens: Während in "Flash" trotz seiner fundamentalen philosophischen Implikationen Religion keine Rolle spielt, wird sie in "Credo" zum Hauptaspekt der Handlung.
Aber das soll kein Anlass zur Häme sein, auch "Credo" kann was. Das Team um den charismatischen Forschungsleiter Gregory Hazelius hat gerade ganz CERN-gemäß die ersten Teilchen auf Kollisionskurs geschickt, da ergeben sich auf dem "Visualizer", der die Resultate zeigen soll (technische Einzelheiten vernebelt Preston großzügig) unerwartete Muster, die sich schnell als einfache Botschaft entschlüsseln lassen: "SEID GEGRÜSST." Die Suche, wer sich da in die superteure Anlage eingehackt haben kann, bleibt ergebnislos - die anfangs skeptischen WissenschafterInnen beginnen sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass jemand aus der Quantenwelt heraus mit ihnen kommuniziert. Jemand, der sich in Ermangelung eines besseren Wortes als "Gott" bezeichnen lässt und durchaus eine Botschaft an die Welt auszurichten hat: Wissenschaft ist Religion. Die eine, wahre Religion, lautet der Kernsatz des neuen Evangeliums.
Da sich das Team, von der Kommunikation mit Gott völlig in Beschlag genommen, von der Außenwelt zunehmend abschottet, wird der Regierungsbeauftragte Wyman Ford, die Hauptfigur des Romans, nach Arizona geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Er hat nicht nur Kybernetik und Kryptographie studiert, sondern auch Ethnologie: das ermöglicht ihm offiziell die Funktion einer Kontaktperson zu den Navajo, auf deren Gebiet "Isabella" gebaut wurde, einzunehmen. Außerdem hatte er mit "Isabella"-Teammitglied Kate Mercer einst eine Beziehung (und das ist nun wirklich eine sehr hollywoodeske Wendung Prestons ... "Credo" wird einer Verfilmung ja förmlich entgegen getragen).
Auch andere sind aber aufmerksam geworden: Der Tele-Evangelist Don Spates findet in dem Projekt, mit dem seinen Worten nach "ein Beweis gegen die Schöpfungsgeschichte gefunden werden soll", ein willkommenes Thema, um seine schwindende Gemeinde zu mobilisieren ... vor allem zum Spenden natürlich. Angesetzt darauf hat ihn zynischerweise ein Lobbyist in Washington, der den Navajo einst den einträglichen "Isabella"-Bau bescherte, nun aber nicht mehr von ihnen gebraucht wird und ihnen durch die Kampagne gerade so viele Schwierigkeiten machen will, dass sie ihn wieder engagieren. Die rein finanziell motivierten Vorgänge geraten völlig außer Kontrolle, als sich Spates den im Gegensatz zu ihm sehr gläubigen Pastor Russ Eddy als Beobachter vor Ort angelt: Als Eddy von den göttlichen Dialogen erfährt, wird aus dem vermeintlich netten alten Landpfarrer ein mörderischer Extremist, die Medien-Kampagne mutiert zum blutigen Kreuzzug und das "Isabella"-Gelände zum Schlachtfeld: Nicht kleckern, sondern klotzen ist Prestons Devise für die Klimax des Romans.
Es steht "Credo" gar nicht so schlecht an, dass Preston den Roman nicht mit seinem langjährigen Schreibpartner Lincoln Child verfasst hat. Auf jeden Fall von Vorteil ist aber, dass auf die allzu oft verwendete Formel (prä-)historisches-Objekt-wird-entdeckt-und-löst-haarsträubende-Ereignisse-aus verzichtet wurde. Das Ergebnis ist zwar ein extrem reißerischer Plot mit Schielauge auf politisch-religiöse Strömungen der Gegenwart, plakativ in seinen Figuren und unrealistisch im Ablauf der Handlung - aber spannend. Preston eben. Und der Schluss, der nicht zwiespältig, sondern eher schon drei- oder vierspältig ausgefallen ist, verleiht dem Ganzen eine wirklich interessante Note.

Frank Hebben: "Prothesengötter"
Broschiert, 227 Seiten, € 12,90, Wurdack 2008.
Eine Wortschöpfung Sigmund Freuds aus dessen Essay "Das Unbehagen in der Kultur" stand Pate für den Titel dieser Sammlung, die zu den Highlights des Jahres gezählt werden darf. In 13 zuvor in Anthologien oder Magazinen erschienenen Kurzgeschichten aus den Jahren 2005 bis 2008 widmet sich der deutsche Autor Frank Hebben der Verschmelzung des Menschen mit der von ihm geschaffenen Technik und dem Konflikt zwischen dem Individuum und seinen erdrückenden Rahmenbedingungen.
Hebbens durchwegs düstere Visionen erstrecken sich von einer Cyperpunk-artigen Nah-Zukunft hin zu fernen Maschinenzeitaltern - mit ein, zwei Ausnahmen könnten die Geschichten aber vielleicht sogar in eine gemeinsame Zeitlinie gestellt werden. Vertraute Cyperpunk-Szenarien bieten etwa "Memories" und "Im Labyrinth der Neonrose", in denen Erinnerungen als Ware gehandelt werden und persönliche Identitäten sich entsprechend im Fluss befinden. Vor dem gleichen 22. Jahrhundert-Hintergrund spielt sich auch "Maronettentheater" ab, geht jedoch bereits einen Schritt weiter: Der Protagonist Köhler hat sich aus künstlich gezüchteten Organen einen Quasi-Menschen, den Burattino, zusammengenäht, den er als Fleischkonsole verwendet, um sich in die Hyperrealität des globalen Datennetzwerks einzuklinken. Auf der Flucht vor den übermächtigen powers that be kann Köhler zeitweise auf die Hilfe einer Subkultur mit eigener Infrastruktur aus schwarzen Stromleitungen oder schwarzen Kliniken zurück greifen, wie sie auch in anderen Geschichten erwähnt wird. Viel Hoffnung für revolutionär Gesinnte besteht jedoch nicht.
Irgendwann muss das Internet-Zeitalter dann zu Ende gegangen sein, denn einige Geschichten spielen sich in einer dystopischen Epoche ab, die ausdrücklich nach dem Untergang des als Kosmos bezeichneten WWW angesiedelt ist. Darunter das großartige "Das Fest des Hammers ist der Schlag", die vielleicht schlimmste Albtraumvision Hebbens: Unter der Oberfläche einer vollkommen vergifteten Industriewelt tragen mit Krupp-Luftröhren und anderen künstlichen Körperteilen am "Leben" gehaltene Arbeiter, Maschinisten und Öler einen Krieg unter Tage aus. Im Auftrag von Konzernen, die mit ihren Schutzwehren um die letzten Rohstoffreserven kämpfen, bleiben die ProtagonistInnen Abbas und Ela Gefangene einer Welt des totalen Niedergangs.
Noch weiter in der Zukunft scheinen "Omega", in dem ein neuer Kosmos entsteht und mit Motiven aus der griechischen Mythologie verwoben wird, das völlig abgedrehte "[002:32:45]" und "Gelée Royale" zu liegen. Letzteres die Geschichte des Rechenknechts Chémo, der als Biomechanoid mit Speichertumor seiner Funktion nachgeht - außerhalb seiner Container-Wabe liegt eine tote Welt mit Salzsäuremeeren und molochartigen Industriestädten. Chémos Dasein ähnelt weniger dem eines Menschen als dem der künstlichen Bienen, die ihn eines Tages in seiner Wabe besuchen: Sie spiegeln die auf die Spitze getriebene Klassengesellschaft dieser Endzeit wider, bilden aber zugleich den einzigen (winzigen!) Hoffnungsschimmer. Außerhalb der - möglichen - Zeitlinie schließlich sind "Imperium Germanicum" und das kaum dreiseitige "Exodus 1906 AD" angesiedelt: Ersteres die apokalyptische Fortsetzung eines Ersten Weltkriegs, der nach 30 Jahren immer noch fortwährt (mit zwei alternativen Enden, die verschiedene Deutungen bieten), zweiteres eine einzelne schlaglichtartige Szene, in der die letzten Menschen, flankiert von sie verhöhnenden Maschinenwesen, einen Emigranten-Zeppelin besteigen. Der Prothesengott Mensch wird von seinen "Hilfsorganen" endgültig zum ausgedienten Objekt degradiert.
"Prothesengötter" liefert, kurz gesagt, 13 überzeugende Argumente für die Erzählform Kurzgeschichte - ein Buch für alle, die sich gerne plätten lassen!

Brian Keene: "Der lange Weg nach Hause"
Broschiert, 159 Seiten, € 9,20, Otherworld 2008.
Nicht lange mit privaten Vorgeschichten, wie sie speziell Katastrophenfilme so gerne auswalzen, hält sich Brian Keene für das apokalyptische Szenario von "Take the long way home" auf: Wir steigen direkt bei einem Autounfall ein - nur einer aus einer ganzen Serie im Gebiet von Baltimore und weit darüber hinaus, wie sich schnell herausstellt. Das Ergebnis ist eine Blechschlange von Horizont zu Horizont, die sich nicht mehr in Bewegung setzen lässt und die die vormaligen AutofahrerInnen sukzessive in den zivilisatorischen Verfall treibt. Windschutzscheiben und Zähne brachen. Reifen und Bauchdecken rissen. Öl und Blut flossen, heißt es zur Beschreibung für eine der zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen nach dem Desaster im knappen Stil Keenes - der Kürze der Erzählung, einer Novelle, angemessen. Eine Kompaktheit übrigens, die in Zeiten, da viel öfter 700-seitiger Stillstand in epischer Breite konstatiert werden muss, ihren Reiz hat.
Das grundlegende Szenario - der Stau als Sinnbild einer dysfunktional gewordenen Gesellschaft - ist seit den 60ern ganz gerne mal verwendet worden (vgl. etwa Julio Cortázars "Südliche Autobahn"). Doch Keene ist in der Phantastik, genauer gesagt: in extravaganten Randzonen des Horrors, tätig. Und schon bald müssen sich die ProtagonistInnen daher der Erkenntnis stellen, dass sie es mit keinem natürlichen Phänomen zu tun haben. Ob Invasion durch Außerirdische oder doch das Jüngste Gericht, keine Möglichkeit lassen sie unbedacht. Woher der Wind weht, deutet sich allerdings schon auf den ersten Seiten an (und es geht Keene auch nicht um die Erzielung eines Überraschungseffekts): ZeugInnen berichten, dass die vor der Unfallserie gehörte "Explosion" eigentlich eher wie eine Trompete klang ... Ein Helfer in der Not namens "Gabriel" tritt auf. Und es verschwinden Menschen - interessant freilich welche: ein Baby etwa oder ein wiedergeborener Christ.
Zwei Freunde des Letzteren, der Jude Steve und der schwule Frank, wurden wie der Großteil der übrigen Menschen zurück gelassen. Sie kämpfen sich nun die verwüstete Interstate entlang nach Hause und gehen dabei die geballte Ungerechtigkeit und innere Unlogik einer biblischen Apokalypse - wen sie bestraft und wer verschont bleibt - durch: Diese Reflexion des Themas ist es, die "Take the long way home" so interessant macht. Nur einen Aspekt hat Keene entweder ausgeklammert oder vergessen: Nämlich den nicht unbedeutenden Teil der Weltbevölkerung, dem der jüdisch-christlich-muslimische Mythenkomplex nicht einfach nur am Arsch vorbei geht, sondern der ihn nicht einmal kennt. Wie sich Hindus und Animisten wohl das Ereignis erschließt? - In einem Nachwort schildert Keene dann sein durchaus tragisches Verhältnis zum Christentum und zu Religion an sich. Ein sehr interessanter Autor jedenfalls! Mehr von und über Brian Keene in einer der nächsten Rundschauen.
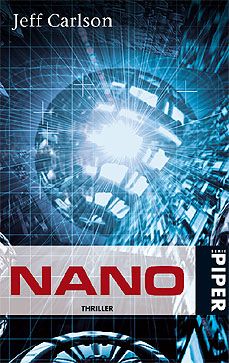
Jeff Carlson: "Nano"
Broschiert, 397 Seiten, € 9,20, Piper 2008.
Jorgensen war der Erste, den sie aßen. Für sein Roman-Debüt hat sich der kalifornische Autor Jeff Carlson die Goldene Regel, dass es auf den ersten Satz ankommt, wirklich zu Herzen genommen. Und düster geht es weiter: Eine Seuche hat den Großteil der Menschheit ausgelöscht - in Variation eines klassischen SF-Themas stecken aber weder Virus noch Bakterium dahinter, sondern sich selbst reproduzierende Nanobots, die - makabre Ironie - vermutlich zur Bekämpfung von Krankheiten geschaffen wurden. Für ihre Vermehrung nutzen die versehentlich freigesetzten Maschinchen nämlich das Körperinnere endothermer Tiere: Vögel, Säugetiere und damit auch fünf Milliarden Menschen wurden binnen kurzer Zeit dahingerafft. Nur über 3.000 Meter Höhe haben sich wegen einer von der Atmosphärendichte abhängigen Sicherheitsprogrammierung der Heuschrecke noch Reste der Weltbevölkerung halten können: Wenige an der Zahl, doch immer noch viel zu viele für die kargen Hochgebirgsregionen der Welt. Ressourcenknappheit und Konflikte bestimmen den Alltag der Überlebenden.
... in Extremfällen bis hin zum Kannibalismus. Wie auf dem abgelegenen Gipfel in der Sierra Nevada, auf den sich der ehemals für die Bergwacht jobbende Cameron mit einem zufällig zusammengewürfelten Häuflein Menschen gerettet hat. Für sie wird schon die Expedition zum Nachbargipfel, auf dem sie sich bessere Chancen erhoffen, zum lebensgefährlichen Unternehmen: Denn jede Stunde im Tal dazwischen überschwemmt ihre Körper mit Nanobots - nur wer sich rechtzeitig wieder über die magische 10.000-Fuß-Grenze rettet, wird die Heuschrecke wieder los; wenn er auch von Narben und Verstümmelungen gezeichnet bleiben wird.
Die zweite Hauptfigur neben Cam ist die Wissenschafterin und Nano-Expertin Ruth Goldmann, die kurz vor dem Ausbruch der Maschinenpest zur ISS gestartet ist und nun, Monate später, mit dem letzten Flug der "Endeavour" zur Erde zurück kehrt. In Leadville, Colorado, wo der Rest der US-amerikanischen Bundesregierung eine Art Staatsgebilde aufrecht erhält, soll sie mit den paar überlebenden ForscherInnen ein Gegenmittel zur Seuche entwickeln. Dabei wird sie mit ein paar bitteren Wahrheiten konfrontiert - und trifft in weiterer Folge auch mit Cam zusammen. Beide sind sie übrigens keine strahlenden HeldInnen: Wo Ruth unter Unsicherheit und gekränkter Eitelkeit leidet, erschweren Cam Schuldgefühle das Leben: nicht nur weil er sich als "Holocaust-Überlebender" fühlt, sondern auch weil die zunehmende Brutalisierung seiner Welt ihn zum Negativen verändert.
Carlson macht recht wenig Hoffnung für die Menschheit, das muss man schon sagen. Konflikte prägen überall das Bild: Ob zwischenmenschliches Gezänk in den Überlebenden-Gruppen, Konkurrenzdenken zwischen den WissenschafterInnen, zu Mord führende Meinungsverschiedenheiten oder sozial bedingte bürgerkriegsartige Entwicklungen im Raum Leadville - bis hin zu veritablen Kriegen in Alpen, Kaukasus und Himalaya, also den Gebirgen, zu denen mehr als nur ein Staat Zugang haben. Und nur Monate nach der beinahe vollständigen Auslöschung der Menschheit fällt bereits wieder - man glaubt es kaum - das Wort Erstschlag. - Zeitgleich mit dem Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe des Romans (Originatitel: "Plague Year") ist in den USA bereits ein zweiter Band herausgekommen, der folgerichtig "Plague War" heißt und hoffentlich genauso packend ist wie Teil 1.
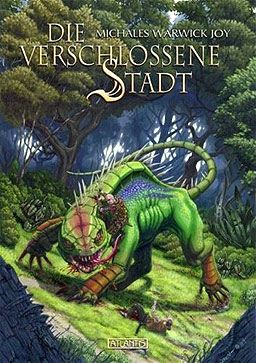
Michales Warwick Joy: "Die verschlossene Stadt"
Broschiert, 260 Seiten, € 13,30, Atlantis 2007.
Seit 300 Jahren ist die Verschlossene Stadt von ihrer Umwelt mehr oder weniger abgeschottet: Raus kommt man kaum - dafür wird einmal im Jahr ein Schwung von ansiedlungswilligen Flüchtlingen in die Stadt eingelassen. Deren Hauptanreiz: Magie ist hier streng verboten. Durch den konstanten Zustrom ist es innerhalb der quadratisch angelegten Stadtmauern aber ziemlich eng geworden: Die BewohnerInnen hocken buchstäblich übereinander, es wird konstant nach oben gebaut, Straßen und Plätze verschwinden unter Wohnraum, Sonnenlicht ist in den meisten Häusern zur wehmütigen Erinnerung geworden.
Ähnlich originell zeichnet Michales Warwick Joy, der sich daheim in Oklahoma von solcherart metropolitanem Mief wohlweislich fernhält, seinen sympathischen Protagonisten: Margar ist 37 und steckt in einer Art Midlife Crisis. Seine besten Tage als gnadenloser Jäger der magisch aktiven Rotmäntel sind vorbei und der Job ist ohnehin sinnlos geworden, da Margar längst alle ausgerottet hat. Er könnte gemütlich daheim bei Frau und Tochter sitzen - würden nicht plötzlich die Straßen der Stadt mit angenagten Leichen gepflastert.
Margar wird vom Stadtfürsten auf die Fährte der Täter gesetzt, die sich bald als Galao, halb-intelligente Tiere der Legende, entpuppen. Zusammen mit dem Söldner Glazier, dem Samurai Okogawa von einer kleinen Insel, die denkt, sie wäre größer und der Ordensadeptin Aneka zieht er in den Kampf. Lockerer Umgangston, eine gesunde Respektlosigkeit (auch gegenüber Autoritäten) und die Gabe allzeit bereit zum Streit zu sein, prägen das Gefüge der heterogenen Gruppe.
Überraschende Entwicklungen werden bei Joy großgeschrieben: Vermeintlich vielversprechend aufgebaute Nebenfiguren kommen beiläufig zu Tode und die Handlung schlägt einige unerwartete Haken. Deren größter - und eher zwiespältiger - ist ein Schauplatzwechsel in der zweiten Hälfte des Romans. Joy verlässt damit nicht nur das sorgfältig aufgebaute Setting, auch der Charakter der Erzählung ändert sich und die Handlung nimmt deutlich Pulp-artige Züge an - Szenarien wie bei Robert E. Howard und Edgar Rice Burroughs entfalten sich auf der neuen Untergrundbühne. Seltsame Entscheidung!

Neal Asher: "Kinder der Drohne"
Broschiert, 590 Seiten, € 9,20, Bastei Lübbe 2008.
Der eigentliche Plot ist rasch erzählt: Ein Abgesandter des Menschen-Imperiums nimmt Kontakt zu einem vergessenen Kolonialsystem auf, das gerade in einen Bürgerkrieg abgleitet. Doch Neal Asher, Autor von unter anderem "Die Zeitbestie" und "Der Drache von Samarkand", wühlt sich bekanntlich gerne bis zu den Achseln in die Trickkiste der Motivik: Es schillert, kracht und qualmt wie eh und je. Neal Asher fordert den literarischen Vergleich mit einem Big-budget-special-effects-Film heraus, hieß es einst zu Recht in einer vom Verlag gerne zitierten "Alien Contact"-Rezension. Und wenn in einer Szene der Gesandte auf dem Rücken einer KI-Drohne in Form eines Tigers aus formvariablem Metall so gewandt übers Meer prescht, dass dessen Tatzen die Wellenkämme malerisch aufschäumen, wähnt man sich gar in einem Anime.
David McCrooger heißt der Gesandte, und er ist ein Alter Kapitän: Er trägt in sich Viren eines anderen Kolonialplaneten, die ihn unsterblich (und ziemlich unverwüstlich) machen - allerdings auch einen zweiten Virenstamm, der sein Leben bedroht und ihm immer mehr Schwierigkeiten bereitet. Trotz seiner überlegenen Konstitution und technischen Ausstattung sieht McCrooger sich als die warmherzige und knuddelige Variante eines Beauftragten der "Earth Central Security". Deren übergeordnete Organisation ist die multiplanetare Polis: Ein von Asher schon für mehrere Romane herangezogenes vermeintliches Utopia von Sternenreich, in dem jeder maßlos reich ist und das von Künstlichen Intelligenzen regiert wird. Die haben zwar - je nach "Persönlichkeit" - allerhand Allüren und Marotten, machen ihren Job aber alles in allem nicht so schlecht. Also sind's die Menschen zufrieden, nur mehr die zweite Geige spielen zu dürfen. Und nicht zuletzt hat sich die Polis den Frieden auf die Fahnen geschrieben.
McCrooger und die schon vor ihm entsandte KI-Drohne "Tigger" stellen daher mit Besorgnis fest, wie der alte Konflikt zwischen den gentechnisch stark veränderten Menschen-Nachfahren auf den zwei bewohnbaren Planeten des Sudoria-Systems wieder aufflammt. Undurchschaubare Rollen spielen dabei der "Wurm", ein quasi-lebendiges Alien-Artefakt, das vor Jahrzehnten im System gefunden wurde, und die mysteriösen Vierlinge Yishna, Harald, Rhodane und Orduval. Alle vier sind hochbegabt, schlagen jedoch höchst unterschiedliche Lebenswege ein (in Rückblenden auf ihren jeweiligen Werdegang wird zugleich die Geschichte des Systems erzählt). Und sie scheinen maßgeblich am wachsenden Konflikt beteiligt zu sein. Das Auftauchen eines Schattenmanns und eine ungewöhnliche Häufung psychischer Störungen auf der Hauptwelt Sudoria vergrößern das Rätsel zusätzlich.
... für dessen Lösung ist dann der Titel der deutschsprachigen Ausgabe ein ziemliches Giveaway. Im Original heißt der Roman "Hilldiggers", benannt nach den gewaltigen Schlachtschiffen Sudorias, die mit ihren Gravitationswaffen ganze Gebirge aufschütten können. Doch nicht alles ist vorhersehbar: Am Ende erwartet den Leser noch ein überraschend zynischer Twist.

Sergej Lukianenko: "Weltengänger" und "Weltenträumer"
Broschiert, 589 Seiten, € 15,50 bzw. 493 Seiten, € 14,40, Heyne 2007/08.
Die Geschichte beginnt mit einem Identitätsverlust - und zwar einem von außen auferlegten: Kirill Maximow, Mitte zwanzig, ist Verkäufer in einem Moskauer Computerladen ... bis eines Tages in seiner Wohnung "schon seit Jahren" jemand anderes lebt, Angehörige ihn nicht mehr erkennen und sein Hund ihn verbellt. Als sich auch noch die Dokumente, die seine Existenz bezeugen, vor seinen Augen auflösen, ist klar, dass mehr als nur eine menschengemachte Verschwörung hinter den Vorgängen stecken muss. Dieselbe mysteriöse Macht, die Kirill seiner bisherigen Existenz beraubt, bietet ihm jedoch eine Alternative: Er wird zum Funktional gemacht - jemand, der in seiner Profession unnachahmliche Vollkommenheit erreichen kann und zu diesem Zweck mit besonderen geistigen und körperlichen Kräften ausgestattet wird. Kein Superheld, eher ein Superarbeiter - und noch dazu einer an der (virtuellen, aber wirksamen) Leine: Denn jedes Funktional ist an den Ort seiner Funktion gebunden, jenseits der Leinen-Reichweite bleibt es ein normalsterblicher Mensch, den - im wahrsten Sinne des Wortes - niemand kennt.
Über dieses Grundkonzept ließe sich bereits prima philosophieren - doch bildet es natürlich nur den Ausgangspunkt einer ebenso vielschichtigen wie actionreichen Handlung. Es gibt auch Kellner- und Friseurfunktionale, was für einen Romanprotagonisten wohl etwas weniger hergäbe ... Kirill hat aber das Glück, zum Zöllner bestimmt zu sein, dem Hüter eines Turms, der zu anderen Welten führt. Lukianenko dreht damit eine früher schon einmal verwendete Handlungsidee (in "Spektrum", 2002) ins Gegenteil um: Damals war der Protagonist der Reisende, der sich mit rätselhaften "Pförtnern" bzw. Schließern konfrontiert sah, Kirill hingegen schlüpft in die komplementäre Rolle. Nichtsdestotrotz darf er die erreichbaren Welten - jeweils auf Leinenlänge - ebenfalls besuchen.
Als Kirill sich gegen seine Zwangsfunktionalität auflehnt, vergrößert sich seine Besuchstätigkeit noch. Und Sergej Lukianenko hat damit wie schon in "Spektrum" Gelegenheit, eine Reihe origineller Welten zu schildern: Veros etwa, eine Art Version der Erde des 19. Jahrhunderts, die statt Nationen nur Stadtstaaten kennt. Oder Feste, wo die weltumspannende Kirche so fest im Sattel sitzt, dass sie es sich leistet großzügig Glaubensfreiheit zu gewähren und - dem "Heiligen Darwin" sei Dank - mittels Biotechnologie Tier- und Pflanzenwelt spektakulär manipulieren kann (schließlich wurden nur die Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen). Allesamt sind es alternative Versionen unserer Erde, und allesamt wurden und werden sie von derselben Instanz, die Kirill zum Funktional gemacht hat, in ihrer Entwicklung manipuliert. Die verantwortliche Instanz und ihre Ziele zu entschleiern macht Kirill sich zur Aufgabe, die sich über beide Bände erstrecken wird. Weshalb diese auch unbedingt zusammen gelesen werden sollten!
Der anhaltende Lukianenko-Boom, von dem inzwischen sowohl seine früheren Werke als auch diejenigen anderer russischer AutorInnen profitieren, geht letztlich auf den Siegeszug der Verfilmungen seiner "Wächter"-Romane zurück, für die Lukianenko auch selbst am Drehbuch mitarbeitete. Und die Bücher spiegeln das Erfolgsrezept der Filme wider: Einerseits werden die Erwartungen an eine spannende Handlung voll erfüllt - und andererseits erhält diese ihre besondere Würze dadurch, dass sie nicht alteingefahrenen Schemata entspricht, sondern sich immer wieder darin gefällt ... ein bisschen anders zu sein. Die Figuren treffen überraschende Entscheidungen und ein scheinbar unvermeidlicher klassischer Showdown kann zur Anti-Klimax mutieren. Auch die Figur Kirills selbst entspricht weder dem Helden- noch dem Antihelden-Stereotyp. Mal tritt er in Ismael-artiger Aufgeschlossenheit der Welt recht großmäulig entgegen, dann macht er sich selbst wieder augenzwinkernd runter. Und mit ihm gleich ganz Russland, dessen - zumindest bei Lukianenko - gefühlte kulturelle Unterlegenheit gegenüber Westeuropa immer wieder thematisiert wird; freilich ohne dass die Figuren davon in eine seelische Krise gestürzt würden.
Jedes Kapitel beginnt mit kurzweiligen alltagsphilosophioschen Abschweifungen Kirills bzw. Lukianenkos über gutes Essen, das Fernsehen, die Beliebtheit von Hausmänteln, kurz: über Gott und die Welt. Anspielungen auf Science Fiction- und Fantasywerke - russische ebenso wie westliche - werden fröhlich mit der Gießkanne ausgeschüttet und überhaupt sorgen humoristische Splitter immer wieder für Auflockerung. Eine hör- und bewegungsmäßig herausgeforderte Person mit alternativer Körperhaltung als Umschreibung Quasimodos ist kein schlechter Kommentar zu den sprachlichen Blüten der Political Correctness - und all so etwas mit durchaus ernsthaften philosophischen Betrachtungen und einer ungebrochen spannenden Handlung zu verweben, das ist Lukianenkos große Kunst.

Frank Schweizer: "Grendl"
Gebundene Ausgabe, 175 Seiten, € 18,50, Otherworld 2007.
Apokalypsen sind in dieser Rundschau ungeplantermaßen recht stark vertreten - so witzig wie diese ist allerdings keine andere geraten. Und das, obwohl jemand, der wie der Stuttgarter Phantastik-Neuling Frank Schweizer über "Bunte Steine"-Autor Adalbert Stifter promoviert hat, nicht automatisch in den Verdacht rückt ein humoristisches Feuerwerk abzubrennen. Zur Handlung:
Nach 24 Semestern hat Max Merkur endlich seinen Magister-Titel in Philosophie erworben - da geht die Welt unter und Max findet sich in der Katholiken-Wartehalle am Apparat des Jüngsten Gerichts wieder. Nur kurz währt seine Freude, dass der Friseur, der ihm einst seine Jugendträume vom Billy Idol-Haarschnitt vermasselt hat, zur Hölle fährt, da wird ihm selbst der Durchgang durch den Apparat verwehrt. Durch eine seltene Faktoren-Kombination während seines Ablebens kann es für ihn weder nach oben noch nach unten gehen, Max ist für eine besondere Aufgabe vorgesehen: Er soll den Weltuntergang rückgängig machen. Das wünschen sich ausgerechnet die Teufel - nicht nur, weil der Wind in jüngster Vergangenheit endlich in ihre Richtung geblasen hat und immer mehr Menschen zur Hölle statt in den Himmel geschickt wurden. Auch dass der Weltuntergang den Server für das brandneue Online-Portal der Hölle zum Absturz gebracht hat, ergrimmt sie.
Max wird, begleitet vom Teufel Lutherion, auf Zeitreise zu den wichtigsten Philosophen der Menschheitsgeschichte geschickt. Einer von ihnen muss einfach den Sinn des Lebens kennen: den letzten Faktor, den die Teufel in ihre ausgefeilte Weltformel einsetzen müssen, um die Existenz gleichsam zu rebooten. So lässt Schweizer, selbst studierter Philosoph, Max nicht nur Sokrates und Wittgenstein treffen, er begegnet auch dem Gedächtnis (und dem Vergessen!) der Welt sowie dem Titel gebenden Urbösen Grendl. Und auch wenn er hier nicht verraten wird: der Sinn des Lebens wird gefunden und genannt werden! Mal ganz davon abgesehen, dass auch geklärt wird, wohin die Neandertaler verschwunden sind und wo der Ursprung des Witzes "Woran erkennt man, dass ein Elefant im Kühlschrank war?" liegt ...
Bei einer Fantasy- (bzw. Magic Realism-)Parodie liegt der Verweis auf Terry Pratchett recht nah. Tatsächlich ist der Humor in "Grendl" aber eher mit dem von Douglas Adams verwandt - werden doch nicht nur die Mechanismen des parodierten Genres, sondern streckenweise auch die Romanhandlung selbst ad absurdum geführt. Etwa wenn Max und Lutherion am Rande des Großen Nichts stehen: Anlass für reihenweise Wortspiele, für die es keine "praktische" Umsetzung geben kann. Und auch die Handlung von "Grendl" zeigt - ohne eine simple Übertragung in ein anderes Genre zu sein - deutliche Parallelen zu "Per Anhalter durch die Galaxis": Vom Weltuntergang als Auslöser bis zu Lutherion als höllischem Pendant zu Ford Prefect, der für den orientierungslosen Helden Max respektive Arthur Dent den Führer spielen muss. Am Ende des Universums bzw. am Rande des Nichts gibt es hier übrigens zwar kein Restaurant, aber wenigstens einen Kiosk, in dem bemerkenswert schundige Philosophen-Souvenirs feilgeboten werden (allerliebst der Trachtenhut, an dem statt eines Gamsbarts der von Nietzsche flattert ...).
Mit Hellzapoppin-artigem Tempo jagt ein skurriler Einfall den anderen: Da brauen mittelalterliche Hexen ihre Zaubertränke im modischen Wok aus dem Bestellkatalog, vergeben die Teufel Sammelpunkte für böse Taten oder laufen hirntote Radio-Gewinnspiele in den Zeitreise-Kanälen. Was klar macht: "Grendl" ist nicht nur die gelungene Verarschung eines boomenden literarischen Genres - sondern vor allem ein wirklich witziger Zerrspiegel unserer realen Welt in all ihrer absurden billigen gloriosen Plattheit. Die darf einfach nicht untergehen!
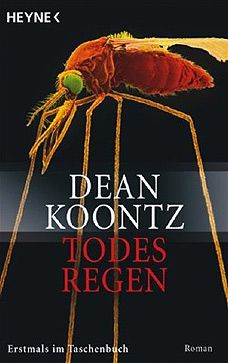
Dean Koontz: "Todesregen"
Broschiert, 399 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
Wie der andere Vielschreiber und Nochmehrverkäufer der Gruselliteratur, Stephen King, hat auch Dean Koontz - no na - sein Handwerkszeug im Lauf der Jahrzehnte so effektiv geschliffen, dass der Leser bei der Stange bleibt. Erst möchte man sich noch mokieren, dass gleich auf den ersten Seiten die Hauptfiguren, die 28-jährige (ausgerechnet!) Romanautorin Molly Sloan und ihr Mann Neil, anhand ihrer Eckdaten in etwas uneleganter Weise runterbeschrieben werden. Dann folgt aber schon eine Szene, in der Molly von ihrem Haus aus beobachtet, wie merkwürdig fluoreszierender Regen niederprasselt und sich eine Schar Kojoten ängstlich auf ihrer Veranda versammelt. Ein irgendwie magisches Bild, und man denkt: Verdammt, hat er einen schon wieder gepackt!
Molly und Neil ahnen schnell, dass mit dem Regen mehr als nur Wasser vom Himmel kommt: Menschen verschwinden (Originaltitel: "The Taking"), andere werden verstümmelt, nicht-irdische Lebewesen scheinen sich auszubreiten. Aus bruchstückhaften TV-Informationen erfahren die Sloans, dass die beunruhigenden Phänomene global, ja selbst auf der ISS, auftreten, und machen sich ins nahe Städtchen Black Lake auf, um sich und andere zu retten.
Im Vergleich zu King neigt Koontz tendenziell eher zu Science Fiction-artigen Plots: Von genmanipulierten Tieren ("Watchers") über Lebensformen aus der Urzeit ("Phantoms") bis zum Erbe einer untergegangenen Zivilisation ("Twilight Eyes") reichte die Palette bislang. Auch worauf "The Taking" hinauszulaufen scheint, ist SF-LeserInnen wohlbekannt - in beispielsweise David Gerrolds "Biologischer Invasion" oder Ian McDonalds "Tendeléos Geschichte" fiel der Menschheit ebenfalls ein komplettes fremdes Ökosystem auf den Kopf. Doch Achtung, nicht mit der "falschen" Einstellung an das Buch herangehen: Denn im Gegensatz zu obigen Beispielen geht es Koontz natürlich primär um die Erzeugung von Schrecken. Wenn Molly einen außerirdischen Pilz erblickt, heißt es: Trotzdem spürte sie beim bloßen Augenschein, dass dieses Ding von Grund auf bösartig war. Ein Pilz. Wer das Buch unter einer Horror-Prämisse liest, kann derlei durch nichts begründete Intuitionen einfach schlucken - in einem SF-Kontext würde man sich hingegen fragen: Warum? Es wird nebenbei bemerkt ziemlich viel an Schrecken behauptet - weniger erzeugt. Lovecraft lässt in "Todesregen" in mehrfacher Weise grüßen: Auch beim Großmeister des verbalen Dauerfeuers konnten ja durchaus heimtückische Blätter an den bösartigen Zweigen gotteslästerlicher Bäume rascheln ...
Die Auflösung dessen, was da auf der Erde abläuft, und vor allem wie selbstverständlich die beiden HeldInnen dies akzeptieren, wirft dann ein schon befremdliches Licht auf Koontz' Weltsicht. Übel! Wenngleich es keineswegs unerwartet kommt: Immerhin lässt der Autor seine ProtagonistInnen im Verlauf des Romans mehrfach von der guten alten Zeit schwärmen, egal ob es um Moral, Architektur oder Unterhaltung geht. Reality-Shows pfui, alte Hollywoodfilme hingegen ein Grund für Nostalgie - inklusive Western. Ja, das waren noch Zeiten, als Indianer abgeknallt werden durften und nicht als Casino-Besitzer reich wurden ... Aber Koontz ist mittlerweile 63 und die Welt eben ein wenig komplizierter geworden. Kurzgefasst: Möge er noch viele Bücher schreiben und nicht in die Politik gehen.
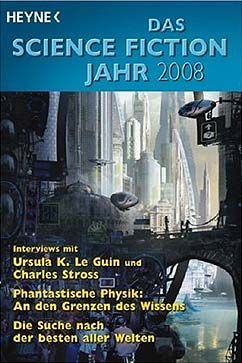
Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction-Jahr 2008"
Broschiert, 1493 Seiten, € 22,70, Heyne 2008.
In seiner eigenen Liga spielt wie gehabt der traditionelle Jahresrückblick des Heyne-Verlags auf das Thema Science Fiction in all seinen Erscheinungsformen. Dem 1493 Seiten langen (bzw. satte 0,9 Kilogramm schweren) Kompendium ist fast nur mit einer quantitativen Beschreibung gerecht zu werden:
An die 320 Seiten sind dem Schwerpunkthema des Jahres gewidmet: Der Utopie und ihrer düsteren - aber deutlich beliebteren - Schwester, der Dystopie. Die Zugänge reichen vom semi-belletristischen "Besuch im Museum des Neuen Menschen" Uwe Neuholds bis zu einer Reihe akribischer Aufarbeitungen der Literaturgeschichte der Utopie, unvermeidliche Überschneidungen inklusive. Zum Motto passend auch Peter Kempins & Wolfgang Neuhaus' Aufsatz "Invasion der Cognoiden" und zwei ausführliche Interviews mit visionären SF-AutorInnen: Ursula K. Le Guin, der gewohnt souveränen Doyenne der Science Fiction und Fantasy ("Sie [die Verleger, Anm.] wollen immer, dass man den letzten Erfolgsroman noch einmal schreibt. Man muss sie ignorieren."), sowie dem auch als Interviewpartner mitreißenden "Accelerando"-Autor Charles Stross.
Die frühen Jahre des umstrittenen Robert A. Heinlein und schriftstellerische Reflexionen des Tunguska-Ereignisses von 1908 sind Teil des 170 Seiten langen Literatur-Abschnitts. Auf über 400 Seiten wird SF in Medien wie Comics, Computerspielen und - vor allem natürlich - Film behandelt (eine wahre Tour de Force: Peter M. Gaschlers "The Remake Game" über die Wiederverwertung alter Stoffe durch Hollywood), gefolgt vom für den Geldbeutel notorisch gefährlichsten Teil: den Buchrezensionen, insgesamt 28 Stück quer durch die deutschsprachige Verlagsszene. Fast genauso viel Platz nehmen interessanterweise die Besprechungen zu wissenschaftlichen Sachbüchern ein, ergänzt um zwei lange Artikel über 1) Wurmlöcher, Paralleluniversen und Pseudowissenschaft sowie 2) das allgegenwärtige Thema Klimawandel (inklusive einer gewagten Punktevergabe für die Argumente von Warnern und Skeptikern ... würden wir so etwas bei uns im Wissenschaftsressort tun, bräche der Große Forenkrieg aus!).
Den Abschluss machen Fakten, Fakten, Fakten: Aktuelle Zahlen vom deutschsprachigen, amerikanischen und britischen Phantastik-Markt sowie (augenbetäubend!) Auflistungen erschienener oder geplanter Titel. - All das ergibt ein hochwillkommenes Nachschlagewerk für alle, die über den reinen Lesespaß hinaus an Science Fiction & Co als Kulturform interessiert sind und sich den Luxus gönnen, im SF-Buchschrank ein Sekundärliteratur-Regal zu führen. Welches angesichts des alljährlichen Heyne-Wälzers allerdings auf Tragfähigkeit angelegt sein sollte. Sehr empfehlenswert - wie immer.
Und in der nächsten Rundschau reisen wir voraussichtlich mit Mungo Carteret zu exotischen Welten im All und mit Scott Sigler ins Innere unserer eigenen. Genauer wissen wir's in einem Monat - derzeit lässt sich echt aus dem Vollen schöpfen!
(Josefson)