
Eine Physikkonferenz in Finnland entpuppte sich als prägende Inspiration für Fariba Karimi. Sie war die einzige Frau unter den Anwesenden. Dem nicht genug, bestand die Afterwork-Aktivität in einem Saunagang. "Komplett nackt, selbstverständlich", sagt Karimi. "Sie können sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe."
Das war gerade einmal vor etwa zehn Jahren. Damals arbeitete Karimi an der Universität Umeå in Schweden an ihrem Doktorat zu komplexen Systemen in der Physik. Zuvor hatte sie in ihrer Heimat Iran und im schwedischen Lund Physik studiert. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der Abteilung für Computational Social Sciences des Kölner Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften landete sie 2021 in Österreich. Heute leitet Karimi am Complexity Science Hub (CSH) in Wien eine Forschungsgruppe zum Thema "Algorithmic Fairness". An der TU Graz hat sie eine Professur für Computerwissenschaften.
Die finnische Konferenz war nicht das einzige Mal, dass sich Karimi allein unter Männern wiedergefunden hat. Immer wieder stieß sie auf Unglaubliches. Der entscheidende Anstoß, sich genauer mit der Repräsentation von Frauen in der Physik – und in der Folge generell mit Minderheiten in jeglicher Art von Netzwerken – zu beschäftigen, kam wenige Jahre später. 2018 löste eine sexistische Rede des italienischen Forschers Alessandro Strumia eine Welle der Empörung aus. Bei einem Workshop des Genfer Kernforschungszentrums Cern behauptete er unter anderem, dass die Physik "von Männern erfunden und aufgebaut" worden sei und Frauen ohnehin zu emotional seien, um Physik betreiben zu können. Strumia wurde zwar umgehend vom Cern suspendiert, verbreitet aber weiterhin, unter anderem auf sozialen Medien, dass Physik ein Männerding sei.
Männer haben einen historischen Vorteil
Fariba Karimi wollte es genau wissen und faktenbasiert erklären, warum Frauen in naturwissenschaftlichen Fächern, wie eben in der Physik, noch immer in der Minderheit sind und kaum in Top-Positionen kommen. "Ich schaute mir also Physikpublikationen aus 100 Jahren an", schildert Karimi. Grundlage dafür war die Datenbank der renommierten American Physical Society. Gemeinsam mit ihren Masterstudierenden verglich sie je ein Paper von einer Frau und von einem Mann, die ähnliche Inhalte hatten und zur selben Zeit publiziert wurden. Dann analysierten sie, wer mehr Aufmerksamkeit bekam, öfter zitiert wurde. Bei insgesamt 541.000 Arbeiten, die zwischen 1893 und 2010 erschienen, fanden sie knapp 10.000 Erstautorinnen und etwa 60.900 Erstautoren.
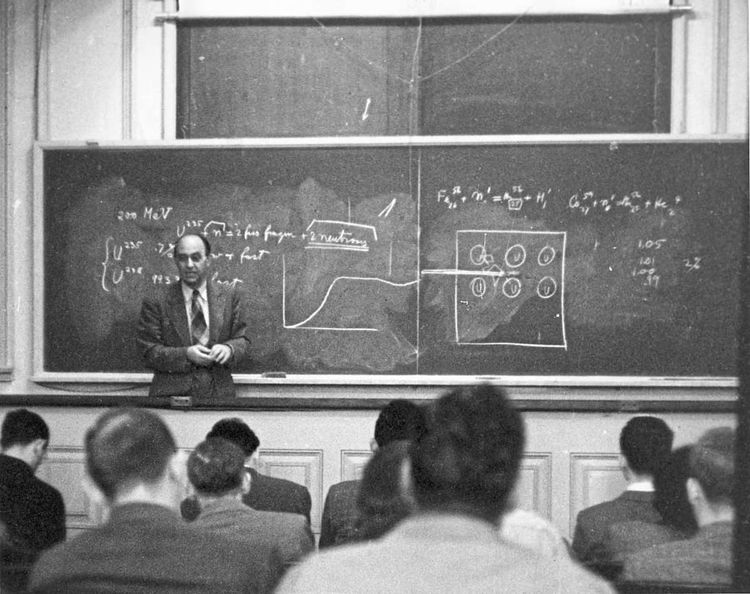
"Zu unserer Überraschung stellten wir bei der Betrachtung der statistischen Zwillinge fest, dass beide in etwa gleich oft zitiert wurden. Das bedeutet, dass die Arbeit von Frauen gleichwertig ist und die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient", sagt Karimi. Das Problem war jedoch ein anderes. Männer veröffentlichen seit Anbeginn, Frauen kamen erst viel später und sehr langsam dazu, wie die Analysen, die 2022 im Fachjournal "Communications Physics" publiziert wurden, zeigten. Das Phänomen wird "first-mover advantage" oder "Pionier-Vorteil" genannt. Diejenigen Personen, die zuerst eine Forschungsarbeit zu einem bestimmten Thema veröffentlichen, werden üblicherweise öfter zitiert als jene, die nachfolgen. Und eben weil Frauen lange Zeit Barrieren in den Weg gelegt wurden, haben Männer gewissermaßen einen historischen Vorteil.
Boys Clubs und Role Models
"Denken Sie an Marie Curie, die keinen Abschluss machen durfte ohne die Zustimmung ihres Mannes", sagt Karimi. Frauen wurden lange Zeit systematisch daran gehindert, in höhere akademische Sphären aufzusteigen. Das wurde dadurch verstärkt, dass die etablierten Männer Netzwerke bilden – Karimi nennt sie "boys’ clubs –, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, wer gefördert wird und wer nicht. "Es gibt so viele Frauen in der Geschichte, die all die mathematischen Kalkulationen für die Physiker gemacht haben, aber nie in einem Paper genannt wurden und irgendwann zu Sekretärinnen degradiert wurden", sagt Karimi.
"Diese strukturelle Ungleichheit führt dazu, dass die Frauen der nächsten Generation keine Vorbilder haben, sich unsichtbar und ignoriert fühlen. Und das führt auch unter Männern zu der Vorstellung, dass das Fach offensichtlich nichts für Frauen ist. So setzt sich die strukturelle Ungleichheit über Generationen hinweg fort."

Doch wie lassen sich derartige Verzerrungen, die nicht nur Frauen in männerdominierten Bereichen, sondern auch viele andere Minderheiten betreffen, tatsächlich berechnen? Und wie können sie ausgeglichen werden? Um eine solide Datenbasis zu schaffen, beschäftigt sich Fariba Karimi insbesondere mit dem Konzept der sozialen Homophilie. Im Kern geht es dabei darum, dass wir dazu tendieren, mit Menschen in Kontakt zu treten, die uns ähnlich sind, sei es in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Bildung, Einkommen, Wertvorstellungen oder Interessen. Evolutionär gesehen bargen Interaktionen mit gruppenfremden Personen immer auch Gefahren. Kognitiv gesehen ist es einfach weniger anstrengend, sich nicht mit Neuem zu befassen. Soziale Homophilie beeinflusst also, mit wem wir uns anfreunden, mit wem wir eine Beziehung eingehen, wem wir auf sozialen Medien folgen oder mit wem wir zusammenarbeiten.
Warum Quoten allein nicht helfen
Das Prinzip der sozialen Homophilie, das in den 1950er-Jahren von den Soziologen Paul Lazarsfeld und Robert Merton entwickelt wurde, spielt heute eine wichtige Rolle in der Erforschung komplexer Netzwerke. Karimi und ihr Team zeigten, dass bisherige Methoden bei der Analyse sozialer Netzwerke jedoch an ihre Grenzen stoßen, wenn es etwa darum geht, Vorurteile gegenüber Minderheiten abzubilden. In der Realität sind nämlich oft eine oder mehrere Gruppen zahlenmäßig stark unterlegen, was wiederum beeinflusst, inwieweit eine Minderheit es schafft, in den jeweiligen Netzwerken aufzusteigen, wie Karimi gemeinsam mit Marcos Oliveira von der britischen Exeter-Universität in "Scientific Reports" berichtete.
"Wir sehen erst eine Veränderung, wenn sowohl Mehrheiten als auch Minderheiten anfangen, ihre Netzwerke zu öffnen."
Wie diese Mechanismen funktionieren, exerziert die Komplexitätsforscherin mit ihrem Team anhand von Simulationen und Machine-Learning-Methoden durch genauso wie mithilfe von Datenanalysen realer Netzwerke wie etwa der Entwicklerplattform GitHub. Unter deren mehr als 100 Millionen Usern sind nur sechs Prozent Frauen. "Selbst wenn die Menschen innerhalb einer kleinen Gruppe sich gegenseitig fördern, werden sie durch die Strukturen marginalisiert", sagt Faribi. "Unser Modell zeigt aber auch, dass selbst eine extreme Quotenregelung nicht garantiert, dass Minderheiten in der Rangordnung aufsteigen. Wir sehen in unseren mathematischen Modellen erst eine Veränderung, wenn sowohl Mehrheiten als auch Minderheiten anfangen, miteinander zu interagieren und ihre persönlichen Netzwerke für die jeweils andere Gruppe zu öffnen."

Besonders wirkungsvoll ist es, wenn Personen, die bereits hohe Positionen innehaben, möglichst diverse Menschen um sich scharen und fördern – und sie auch in Führungsfunktionen sichtbar machen, damit sie wiederum als Vorbilder fungieren. Um mehr Bewusstsein für diese Mechanismen zu schaffen, müssen sich aber auch die Gruppen, in denen sich Minderheiten zusammenschließen – wie die vielen Initiativen zur Förderung von Frauen –, ihre Bubbles verlassen und den Dialog mit Menschen suchen, die einen komplett anderen Hintergrund haben, betont Karimi. Visualisiert hat sie das etwa anhand eines von Hunden und Katzen bewohnten Paralleluniversums.
Rassistische Strukturen
Welche Macht die Strukturen von Netzwerken ausüben und wie Ungleichheiten sich darin manifestieren, lässt sich an vielen Beispielen ablesen – man denke nur an ungleiche Bildungschancen von Kindern von Nichtakademikern in Österreich, die Schwierigkeit des ökonomischen Aufstiegs von Zugewanderten oder an die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Wie sehr die Strukturen einer Stadt und ihre Netzwerke rassistische Vorurteile beeinflussen, hat Karimi gemeinsam mit US-Forschenden und der Central European University in einer Studie herausgearbeitet, die kürzlich im Journal "Nature Communications" erschienen ist.
Bei der Verknüpfung von Millionen Daten zu rassistischer Voreingenommenheit und Bevölkerungsdaten aus den USA zeigte sich, dass Rassismus gegenüber People of Color abnahm, je größer, vielfältiger und weniger segregiert eine Stadt ist. "Wir sind soziale Tiere. Die Art, wie wir mit anderen interagieren, beeinflusst, wie wir andere wahrnehmen", erklärt Karimi. "Wir konnten bestätigen, dass Menschen, die mit vielen ethnischen Gruppen interagieren, weniger Vorurteile haben." Insofern kann eine Stadtplanung, die Segregation etwa durch Gleise vermeidet und auf öffentliche Räume setzt, die unterschiedlichste soziale Interaktionen zulassen, auch einen Einfluss auf die Einstellungen der Bewohnerinnen und Bewohner ausüben.

Um einiges unterschwelliger setzen sich all diese Prinzipien auch in den Onlinenetzwerken fort, sei es bei Kontaktempfehlungen auf Linkedin und Twitter/X, bei Rankings von wissenschaftlichen Papers bei Google Scholar oder den Videos, die Youtube vorschlägt. "Unsere Modelle zeigen, dass sich Vorurteile, die in der Gesellschaft existieren, durch die Algorithmen noch einmal verstärken, ob wir das wollen oder nicht", sagt Fariba Karimi. Es sei quasi das Geschäftsmodell von Technologiekonzernen, den Userinnen und Usern das vorzuschlagen und zu empfehlen, was sie ohnehin mögen und ihnen Menschen zu zeigen, die ihnen ähnlich sind. "Auf diese Weise bleiben die Leute am längsten in der App, deswegen gibt es keinen Anreiz, das zu ändern", sagt die Komplexitätsforscherin. "Dadurch wird unser Informationshorizont immer beschränkter, und das wiederum schlägt sich auf unserer Wahrnehmung anderer Gruppen nieder und begünstigt Desinformation und Polarisierung."
Faire Algorithmen für mehr Diversität
In mehreren Forschungsprojekten untersucht Fariba Karimi, wie sich Vorurteile in digitalen Netzwerken formen und verbreiten und in einer Art Feedbackschleife wieder auf die Gesellschaft zurückwirken – und wie man die Algorithmen fairer gestalten könnte. "Wir könnten die großen sozialen Netzwerke so gestalten, dass Minderheiten zumindest entsprechend ihrer Größe sichtbar gemacht werden. Also wenn eine Minderheit 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht, sollte sie dementsprechend vom Algorithmus berücksichtigt werden", sagt Karimi. Dazu brauche es Regulierungen, die mehr Transparenz schaffen oder zumindest eine Opt-out-Möglichkeit aus dem derzeitigen System bieten. Letztlich müsse den Entscheidungsträgern bewusst werden, dass Diversität in mehr Innovation und bessere Wirtschaftsleistung mündet.
Fariba Karimi selbst konnte in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn auf die Unterstützung sowohl von Männern als auch von Frauen zählen – und ließ sich nicht beirren. Zudem hatte sie ein Vorbild in ihrer Mutter: "Sie entschied, Unternehmerin zu werden, nachdem sie vier Kinder bekommen hatte. Und jetzt managet sie drei Mittelschulen für Mädchen im Iran." Karimi ist nun selbst Mutter zweier Töchter und setzt sich auch aus diesem Grund seit Jahren für ein spezielles Anliegen ein, nämlich eine faire Behandlung bei der Vergabe von Preisen für Nachwuchsforschende. In einem Beitrag in "Nature" plädierte sie dafür, aktive Forschungsjahre anstelle von Altersgrenzen als Vergabekriterium einzuführen. Denn wer nach der Geburt eines Kindes oder auch wegen einer Krankheit pausiere, sei oft zu alt, um sich für solche Preise zu bewerben. "Das ist wichtig, weil wir das gängige Bild des erfolgreichen Wissenschafters ändern müssen", sagt Karimi. "Das ist nicht immer Einstein." (Karin Krichmayr, 1.5.2024)
Dieser Text ist im aktuellen STANDARD-Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG erschienen. Das Magazin ist im STANDARD-Onlineshop um € 5,90 erhältlich.