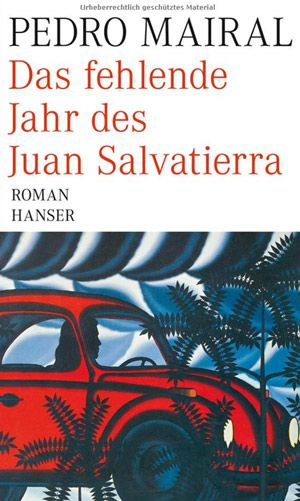
"Die Landschaft schlägt eine Volte, der Himmel ist unten, die Erde oben, als hätte mein Vater die Welt erneut mit der Angst dessen gesehen, der am Steigbügel eines durchgegangenen Pferdes hängt." - Pedro Mairal.
Die Realität fließt. Dieses existenzielle Sinnbild ist in argentinischer Literatur, die oft ihre Geschichten mit dem großen Strom in Verbindung setzt und auf dessen drübere Seite schaut, nicht selten. Die Grenzen der Wirklichkeit verschwimmen, und die Wahrheit ist verdeckt, in den Orten nisten seltsame Träume, und die riesige Stadt wird zum Weltlabyrinth.
Der 1970 in Buenos Aires geborene Pedro Mairal gewinnt in seiner virtuos knappen, präzisen Erzählweise diesen Ansätzen originelle Seiten ab. Sein neuer, von Dagmar Ploetz, der Übersetzerin von García Márquez und Vargas Llosa, kongenial ins Deutsche gebrachter Roman Das fehlende Jahr des Juan Salvatierra beginnt eben unvermittelt mit dem für jede Darstellung wesentlichen Thema Bild - Abbild: "Das Bild (seine Reproduktion)" - die ersten Wörter sind in der Klammer gleich relativiert - "ist im Röell-Museum zu sehen". Betrachten, eine Erzählung aufnehmen: Die Rezeption ist eine Übertragung auf die eigene innere Wand, und so findet sich das Gemälde "in einem langgeschwungenen unterirdischen Gang, der das alte Gebäude mit dem neuen Flügel verbindet. Man geht die Treppe hinunter und glaubt, in ein Aquarium zu tauchen". Dort zieht "über die gesamte innere Wand" das Bild "vorbei wie ein Fluss".
Es ist ein in diesen Dimensionen noch nie geschaffenes, vier Kilometer langes Werk. Juan Salvatierra, der Vater des Ich-Erzählers Miguel, hat es im Laufe von sechzig Jahren gemalt, für jedes Jahr eine enorme Leinwand.
Für diesen Zugang zu seinem Roman, im Original bündig Salvatierra, der in ungemein konzentrierter Form äußere und innere Zustände sowie Realitäten und tiefere Sinnebenen darstellt, braucht Mairal zwei kurze Absätze. Meisterhaft und beeindruckend, wie er die Geschichte mit ihren Rückgriffen in die Vergangenheit eng führt und in hochliterarischer Genauigkeit im Laufe der Zeilen durch die mitschwingenden Hintergründe auf andere Ufer zusteuern lässt.
Nach dem Tod der Mutter überlegen sich Miguel und sein Bruder Luis, die beide eine farblose Existenz in Buenos Aires führen, wie sie sich um das völlig ungewöhnliche Kunstwerk des zwei Jahre zuvor verstorbenen Vaters kümmern sollten.
Salvatierra, wie ihn der Sohn nennt, war mit neun Jahren schwer unters Pferd geraten und in die Wildnis mitgeschleift worden. Danach konnte er kein Wort mehr sprechen. Auf dem Familienanwesen in dem Ort am großen Grenzfluss zu Uruguay machte ihn die Stummheit zum Außenseiter, befreite ihn von der üblichen Männerrolle und ließ ihm die Muße für seine Leinwandrollen.
Auf ihnen stellte er Tag für Tag Menschen, Fauna, Flora, Himmel, Träume, Ereignisse dar, in seinem genauen Stil des Autodidakten, der das Fließende der Realität abbildet. Die Veränderungen gestaltet er so, "als decke er die gewaltsame Metamorphose auf, die jedem Wesen, jedem Ding, jeder Situation innewohnt". Ein Gartenfest geht während der Militärdiktatur in eine Razzia über; die mit zwölf ertrunkene Tochter nimmt der Fluss auf dem Gemälde über die Jahre in verschiedener Gestalt unerbittlich mit. In diesem gigantischen Werk sind - wie oft in argentinischer Literatur - die Grenzen durchlässig. Salvatierra malt keinen Rahmen, keine Schutzzonen, keine abgeschlossenen Szenen. Er "wollte den Eindruck vermitteln, dass ein Geschöpf, war es erst einmal in seine Malerei aufgenommen, den gemalten Raum überwinden und wieder auftauchen konnte". Das fortlaufende Bild erzählt den Maler, er vermag auf seinen Leinwandrollen Lebensrollen zu verstehen und zu verstecken.
Die Besonderheit und die einzigartige Stimmung von Salvatierras Lebensbild bringt Pedro Mairal so eindringlich nahe, dass man es bei der Lektüre zu sehen vermeint. Er spannt es in die Geschichte einer Suche nach einem Jahreswerk, einer Familiengeschichte, nach eigener Vergangenheit und Stellung im Leben. Im Atelierschuppen hängen alle Rollen, nur jene von 1961 fehlt. In diesem Jahr muss etwas passiert sein, folgern die Söhne und kommen einem dunklen Geheimnis auf die Spur, die schließlich auf die andere Seite führt. Zudem geraten sie in Konflikt mit den Behörden und dem Supermarktbesitzer, der das Gebäude kaufen will und zu wilden Methoden greift. Für Miguel löst sich einiges, anderes geht unwiederbringlich verloren. Wie Salvatierra tatsächlich war, bleibt fraglich: "Vielleicht war er für immer dort verborgen, wo sich die zwei Ufer unter dem Wasser berührten."
Beeindruckende Sätze, die existenzielle Unsicherheiten vermitteln. Als Salvatierra die ertrunkene Tochter malt, kommen die Menschen im Bild in die Waagrechte, stehen dann auf dem Kopf, "die Landschaft schlägt eine Volte, der Himmel ist unten, die Erde oben, als hätte mein Vater die Welt erneut mit der Angst dessen gesehen, der am Steigbügel eines durchgegangenen Pferdes hängt". In ihrer Konzentriertheit ist Mairals Prosa deutlich, zugleich vielschichtig weitreichend - und eine faszinierende Lektüreerfahrung. (Klaus Zeyringer, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 15./16. Jänner 2011)