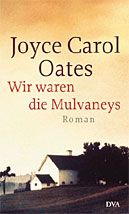
Joyce Carol Oates:
Wir waren die Mulvaneys
Aus dem Amerikanischen von Renate Orth-Guttmann,
€ 25,60/587 Seiten. DVA, München 2003
Die Familie Mulvaney ist so nett und glücklich, dass sie fast wie eine Karikatur wirkt. Man lebt auf einer hübschen Farm, hat keine Eheprobleme und vier wohlgeratene Kinder. Dad hat eine eigene Firma, die Mutter, stets gut gelaunt, werkt zu Hause, managt Kinder, Tiere und Farm und verkauft nebenher auch noch Antiquitäten. Dann wird die Tochter Marianne, das allseits beliebte, strahlende und wohlerzogene Mädchen von einem Schulkameraden vergewaltigt. Marianne gibt sich selbst die Schuld an dem Verbrechen, der Bursche leugnet alles, die Familie, die Gerechtigkeit fordert, gerät ins gesellschaftliche Abseits.
Die früheren Freunde bleiben weg, die Firma geht Pleite, weil der Vater zu trinken beginnt und zunehmend aggressiver wird. Er erträgt den Anblick seiner Tochter nicht mehr, sie wird zu einer Tante verbannt und droht dort psychisch zugrunde zu gehen. Schließlich muss die heruntergekommene Farm verkauft werden. Die Familie zerbricht.
Oates entwirft eine bedrückend isolierte Welt, in der außerhalb der Familie nichts zu existieren scheint. Irgendwann ist von den Einberufungen nach Vietnam die Rede, aber das nur flüchtig. Eine Auseinandersetzung mit der Politik erfolgt nicht. Der älteste Sohn geht später zu den Marines, die Mutter hegt vage Sympathien für Jimmy Carter. Das ist alles, was von Außen in das Vakuum des Clans dringt.