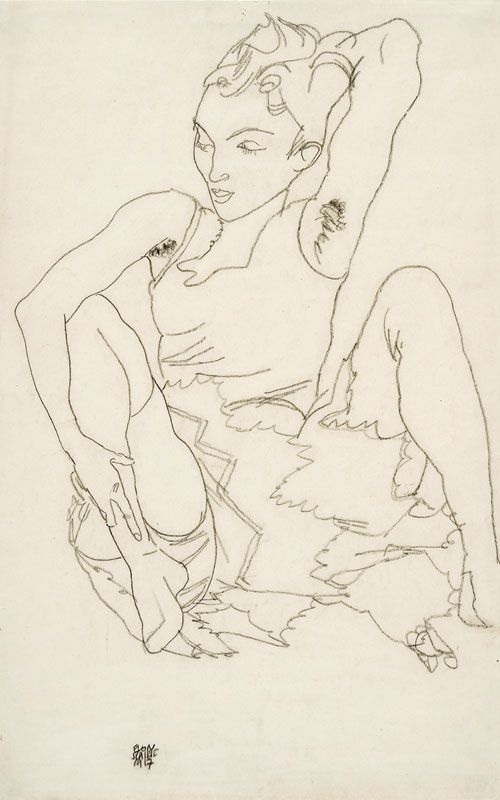Wie tief verankert die Tradition der Täuschung in der Kulturgeschichte der Menschheit ist, führt keine Institution besser vor Augen als die katholische Kirche. Die in ihren Zweigstellen verwahrten Gebeinfragmente von Heiligen könnten zu physiologischen Wunderwerken zusammengesetzt werden, und für die Splitter aus dem Kreuz Christi müssen im Laufe der Jahrhunderte wohl ganze Wälder abgeholzt worden sein. Bis in die 1980er-Jahre drohte enttarnten Fälschern oder in den Betrug Involvierten allenfalls die Exkommunikation. Vernichtet wurden solche Falsifikate notabene nie. Die Echtheit von Reliquien war stets deutlich weniger relevant, als der damit verbundene wirtschaftliche Vorteil: Ein Kloster, das im Besitz eines außergewöhnlichen Objektes war, stieg im Idealfall zum Wallfahrtsort auf und profitierte von den opferbereiten - im Sinne von spendierfreudigen - Pilgern.
Aus historischer Perspektive ist die Situation im Bereich der Kunst eine andere, wie Überlieferungen belegen: Der griechischen Maler Zeuxis vermochte Weintrauben so real zu malen, dass Sperlinge vergeblich auf das Bild einpickten. Die täuschend echte Nachahmung war ein angestrebtes Ideal und folglich ein Bestandteil in der Entwicklungsgeschichte der Kunst. Lug und Trug ließen nicht auf sich warten. Kunstbesitz war bereits im antiken Rom ein Zeichen von Prestige. Da nicht genügend Objekte aus Griechenland oder aus Ägypten verfügbar waren, begann die Faksimile-Industrie zu blühen. Fazit: In diesem Segment sind mehr Plagiate im Umlauf, als je Originale existierten. Dazu war das Kopieren von Meisterwerken vorangegangener Künstlergeneration bis in das 19. Jahrhundert Teil der akademischen Ausbildung.
Schwachstellen des Marktes
Insofern geht es bei Nachahmungen und Fälschungen nicht um ein Phänomen jüngeren Datums, sondern um "natürliches" Zubehör des weltweit florierenden Kunstmarktes. Die Attrappen-Spreu vom Original-Weizen zu trennen gehört dort zum Alltag. Bei Fragen zur Authentizität nutzt man entweder publizierte Fachliteratur oder zieht auf bestimmte Künstler oder Epochen spezialisierte Experten hinzu. Im renommierten Kunsthandel ist das die Norm, bei Online-Plattformen, Tandlern oder kleineren Auktionshäusern dagegen die Ausnahme. Eine Schwachstelle, die Betrüger seit jeher zu nützen wissen, die über diese Peripherie Fälschungen in den Markt einschleusen.
Inzwischen vergeht kaum eine Woche, in der keine entlarvt wird. Öffentlich werden jedoch nur die wenigsten. Betroffene streifen sich bevorzugt das Mäntelchen des Schweigens über: Selbst Museumsdirektoren verbannen das - womöglich über Förderer angekaufte - Kuckucksei eher in den hintersten Winkel des Depots, als sich dem Hohn der Branche auszusetzen. Der Kunsthandel rechtfertigt die mangelnde Transparenz wiederum mit einer potenziellen Verunsicherung seiner Klientel.
Das Problem: Nur die wenigsten Fälschungen werden überhaupt aus dem Verkehr gezogen und kursieren, wiewohl längst und mehrfach enttarnt, weiter auf dem Markt. Ein solcher Fall beschäftigt die Fachwelt seit Jahrzehnten. Konkret ein Bild von Egon Schiele, ein auf Karton gemaltes und 1917 datiertes Werk namens Vorstadthäuser I. Wiewohl es mit Schieles Signatur versehen ist, handelt es sich um eine Fälschung. Vermutlich dürfte sie von seinem Schwager Anton Peschka gemalt worden sein. Seit 1991, erzählt die internationale Schiele-Expertin Jane Kallir, trudeln immer wieder Anfragen zur Bestätigung der Echtheit von Kunsthändlern und Auktionshäusern bei ihr ein, seit 2009 waren es nicht weniger als sechs an der Zahl. Ihre Antwort ist seit 23 Jahren stets dieselbe: Nein, definitiv kein Werk von Egon Schiele. Diese Endlosschleife ist leicht erklärt: Das Bild wechselte abseits der Öffentlichkeit immer wieder - und zuletzt für kolportierte neun Millionen Euro - den Besitzer, die zugehörigen Informationen und Expertisen jedoch nicht.
Eine Mischung aus Naivität und dem festen Glauben an die eigene Unfehlbarkeit lässt sowohl Experten als auch Involvierte in die Falle tappen, wie folgende Episode belegt: 2011 wurde bekannt, dass sich die Oberbank bei der Besicherung eines Kredits in der Höhe von 1,6 Millionen Euro täuschen hatte lassen. Im Mittelpunkt dieser Causa stand ein Ölgemälde mit der Darstellung des Kampf der Zentauren, gemäß Monogramm "E. S." von Egon Schiele.
Da sich Rudolf Leopold bereits aufgrund eines Fotos geweigert hatte, das Bild persönlich in Augenschein zu nehmen, hatten sich die Verantwortlichen der Bank mit der Einschätzung eines ehemaligen Mumok-Restaurators begnügt und von dessen handschriftlichen Recherchen - auf dem Briefpapier der Institution - überzeugen lassen. Nach einem Bericht im Standard meldeten sich ehemalige Besitzer und klärten auf: Das Gemälde stammte von einem arbeitslosen Straßenbahnfahrer und Absolvent eines Volkshochschulkurses. In den 1980ern hatte man es einem Antiquitätenhändler verkauft - allerdings ohne Signatur. Dem Vernehmen nach soll die Oberbank dieses Kuckucksei bis heute im Depot verwahren.
Besitz ist nicht strafbar
Führt die Branche an solchen Fronten einen vergeblichen Kampf? Es hat den Anschein, insbesondere deshalb, weil relevante Informationen kaum geteilt, sondern in individuellen Archiven gehütet werden - eine veritable Schwachstelle auch das. Der Bundesverband Deutscher Kunstversteigerer (BDK) nahm dies 2010 zum Anlass und initiierte die sogenannte "Datenbank kritischer Werke". Seit 2010 wurden dort insgesamt 4000 solcher "Patienten" erfasst, hauptsächlich aus dem Bereich der Klassischen Moderne, davon allein 1400 im Jahr 2014. Der Haken: Bislang steht diese Datenbank nur BDK-Mitgliedern zur Verfügung, nicht jedoch Auktionshäusern oder Kunsthändlern anderer Länder.
Markus Eisenbeis, BDK-Vizepräsident und Eigentümer des Auktionshauses Van Ham, legt allerdings Wert auf die Feststellung, dass es sich nicht um eine Fälschungsdatenbank handelt. Erfasst werden eben "nur" kritische Werke, will heißen solche, an deren Echtheit Experten nachweislich Zweifel haben. Der Wind weht hier von einer anderen Seite: "Aus rechtlicher Sicht ist nämlich der Besitz gefälschter Kunst - ganz im Gegensatz zum wissentlichen Handel - nicht strafbar", erklärt Eisenbeis. An dieser Stelle greife die Datenbank, da diese Dokumentation hilft, eine Betrugsabsicht nachzuweisen.
Die rechtliche Situation muss als weitere Schwachstelle des Systems bezeichnet werden. Vor wenigen Wochen wurde der Fall des deutschen Kirchenrestaurators Christian Goller öffentlich, der über Jahre Meister der Renaissance (u. a. der Cranach-Familie) gefälscht und über Mittelsmänner in den Markt eingeschleust haben soll. In einem Interview gab sich Goller vorerst zuversichtlich: Es handele sich um Kopien, und da er diese weder datierte noch signierte, sei eine Fälschungsabsicht nie und nimmer nachweisbar. Die Ermittlungen des bayerischen Landeskriminalamts laufen noch.
Wie schwierig der Nachweis eines vorsätzlichen Betruges ist, hat der bislang größte Fälschungsskandal in der Geschichte des Kunstmarktes deutlich gezeigt: Es ist der Fall Wolfgang Beltracchi, der sich lediglich für 14 Fälschungen vor Gericht verantworten musste, nicht für 55, auf die die Ermittler damals gestoßen waren. Verurteilt wurde er zu sechs Jahren, die er nun im offenen Vollzug verbüßt. Anderen hatte diese Causa dagegen ein lebenslängliches Urteil beschert: Die Reputation jener Experten, die mit ihren Fehlgutachten die Fälschungen unwissentlich geadelt hatten, ist vorerst Geschichte.
Gemeinsam mit seiner (zu vier Jahren verurteilten) Ehefrau Helene schrieb Wolfgang Beltracchi derweilen zwei Bücher und tingelte zur Promotion selbiger Anfang dieses Jahres von Talkshow zu Talkshow. Jahrhundertfälscher, kommentiert er gerne, sei angesichts von etwa 300 unerkannten Falsifikaten in einem Zeitraum von fast vier Jahrzehnten wohl ein angemessener Titel. So die Mengenangaben stimmen, ist der Verbleib von rund 250 "Beltracchis" bis heute unbekannt.
Den Arbeitstag verbringt Wolfgang jedenfalls in einem eigens im Raum Köln angemieteten Atelier. Dort malt er Bestellungen quasi im Akkord, insbesondere Gemälde im Stile von Max Ernst, aber auch andere. Zum Schlafen geht es zurück in die Haftanstalt, von der er behauptet, sie gleiche eher einem Sanatorium. Er muss Geld verdienen, viel Geld. Die Einnahmen fließen in die Insolvenzmasse, aus der Gläubiger in einer Größenordnung von 20 Millionen Euro abgefunden werden müssen. Dies beschränke sich jedoch nur auf Deutschland, Verdienste aus dem Ausland, plauderte Beltracchi freimütig, fallen nicht darunter. Etwa auch nicht aus der ersten soeben in Bern zu Ende gegangenen Verkaufsausstellung.
Das Schweizer Fernsehen widmete ihm jetzt eine fünfteilige Dokumentationsreihe, die via 3sat ausgestrahlt wurde. Darin gewähren Wolfgang und Helene Einblick in ihren Alltag. Nebenher porträtierte der Meisterfälscher Prominente: etwa Entertainer Harald Schmidt (à la Otto Dix), den Autor Daniel Kehlmann (Giorgio de Chirico) oder den Oscar-gekrönten Schauspieler Christoph Waltz (Max Beckmann). Dem verführerischen Charme der Könnerschaft erlagen sie alle. Am 9. Jänner wird Wolfgang Beltracchi in die Freiheit entlassen. Eines ist schon jetzt gewiss: Als Fälscher ist er längst Teil der Kunstgeschichte, als Künstler (noch) nicht. (Olga Kronsteiner, DER STANDARD, 3./4.1.2015)