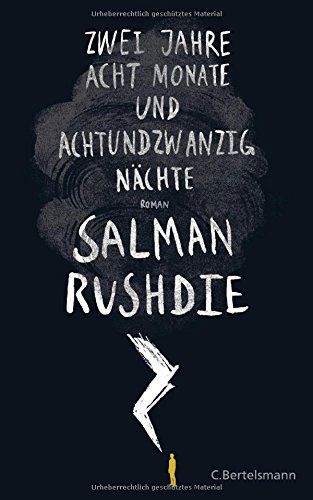Was schreibt man, was kann man noch schreiben, wenn man sich in seiner Autobiografie als "toter Mann" eingeführt hat? Toter Mann nannte sich Salman Rushdie 2012 gleich zu Beginn von Joseph Anton, seinem Rapport in Er-Form über die zehn Jahre, die er infolge der über ihn verhängten Fatwa ab dem 14. Februar 1989 mehr oder minder im Untergrund, abgeschirmt und bewacht von Leibwächtern und Polizei, verbringen musste, in stetem psychischem Ausnahmezustand.
Vielleicht nur noch Märchen. Oder Fantasy. Oder Science-Fiction. All dies hat er nun unter heftiger Bemühung und Paraphrase des Lebensrettungsepos Tausendundeine Nacht mit Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte getan.
Auf Sinnigkeit, gar Sinnhaftigkeit des zu Erzählenden gibt Rushdie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis und seinen englischen Kollegen Kazuo Ishiguro im Hinterkopf, der jüngst nach zehn Jahren Schweigen ebenfalls einen, dazu noch in zivilisatorischer Frühzeit angesiedelten Fantasyroman herausbrachte, wenig.
Dafür ist seine Welt durch Klimakatastrophen eine fast zerstörte, die von überbordend Mythologischem nur so wimmelt. Böse Dschinns und gute Geister kreuchen und fleuchen und fliegen herum, monströse Kreaturen und Graphic-Novel-Zeichner, deren Geschöpfe sich emanzipieren, treten auf, ein ausgesetztes und von der New Yorker Bürgermeisterin adoptiertes Baby, das jeden Korrupten in seiner Nähe mit einem Mal kennzeichnet, Gartenkünstler und weibliche Schönheiten, die zahllose Nachkommen zur Welt bringen, welche sich in vielen Generationen über den Globus verteilen, oder, aus einem Trailerpark stammend, sich hochheiraten und dann zu Mörderinnen mutieren.
Füllhorn der Ideen
Liebes- und Trauer- und Verlustgeschichten sind es, Historien vom Werden, Vergehen, Zerstörtwerden. Dazu noch zwei Philosophen, die höchst unterschiedlich von Humanität und Zynismus, Aufklärung und Pessimismus denken, selbst noch im Grab und über einen Zeitraum von 800 Jahren hinweg miteinander rivalisieren.
Das Ergebnis ist verblüffend. Weil das Füllhorn an Ideen, das Rushdie einsetzt, von ihm nicht einfach nur ausgeschüttet wird. Sondern er schüttelt es nur, das allerdings heftig. Überwiegend verspürt man die Freude, die dieses postmoderne Kreuz-und quer-Pasticcio inklusive zahlreicher Seitenhiebe auf vor allem die amerikanische Gesellschaft ihm bereitet haben muss. Die Freude springt jedoch nicht über, ja diesen Roman als grenzautistisch zu bezeichnen ist so falsch nicht.
Immer wenn Rushdie, der Engländer indischer Herkunft und seit fünfzehn Jahren in New York ansässig, sich als Erzähler der unmittelbaren Gegenwart annahm, war das Resultat, ob Der Boden unter ihren Füßen oder Wut, bestenfalls als unbefriedigend zu bezeichnen. Selbst seine geschmeidigsten Verteidiger schweigen diskret, wenn die Rede auf diese beiden Romane aus den Jahren 1999 und 2001 kommt.
Vor zehn Jahren hat Rushdie mit Shalimar der Narr eine Parabel in Romanform veröffentlicht, in der Liebe auf Terror stößt, West auf Ost, Verführung auf Schicksal, Toleranz auf Rassen- und Religionshass, Tradition auf Libido, Askese auf Brutalität, Lust auf Gewalt, Figuren der mythologischen Welt Indiens auf mediokre Figuren des Tagesgeschehens, Mäßigung auf Raserei, Ignoranz auf Untergang und Fanatismus sich mehr und mehr verquickt mit einem sich potenzierenden politischen Radikalismus.
Jetzt hat er sich einen ausgreifenden Patchwork-Wandteppich fein erstichelt, der am Ende nur mäßig überzeugen will. Eine fatale Fadesse stellt sich zusehends ein, Ratlosigkeit und Verstimmung über den Verlust erzählerischen Talents, das sich hier nun ins Abseitige, Formlose hat forttreiben lassen. Fabulieren verwechselt Rushdie mit postmoderner Leere, die ins Leere geht. Der fliegende Teppich bleibt hartnäckig in Grasnarbenhöhe.
Und dann gibt es doch, hier und da, großartige Sätze, die ins Singen und Schwingen kommen. Es gibt kürzere Passagen und einige wenige Geschichten in Geschichten, die ganz zauberhaft sind, voller Energie und Verve, wo Rushdies Prosa zu schweben anfängt und regelrecht tanzt.
Doch im Ganzen hat er nicht die Kraft, auch nicht den selbstzügelnden Willen, all das Heterogene und dermaßen stark Auseinanderdriftende erzähllogisch in einen überzeugenden Rahmen zusammenzuspannen.
Er hat sich zu viel, viel zu viel vorgenommen, er integriert viel zu viel, er baut zahlreiche Anspielungen von raffiniert bis hartnäckig platt ein inklusive Reverenzen an Autoren des Golden Age of Science Fiction und Comicverfilmungen wie X-Men. Der Magische Realismus, den er meint, mutiert zum künstlichen Plastiktum.
Vielleicht ist es auch ein Signum der Gegenwart, in der ein anderer Autor aus London, Will Self, vor kurzem einen kulturanthropologisch mehr als ernüchternden Abgesang, ja einen düsteren Nachruf auf den Roman als anspruchsvolles komplexes Kunstwerk verfasste, dass einem Erzähler wie Rushdie nur noch Formlosigkeit als kompositorisches Passepartout zur Verfügung stehen will. (Alexander Kluy, Album, 01.11.2015)