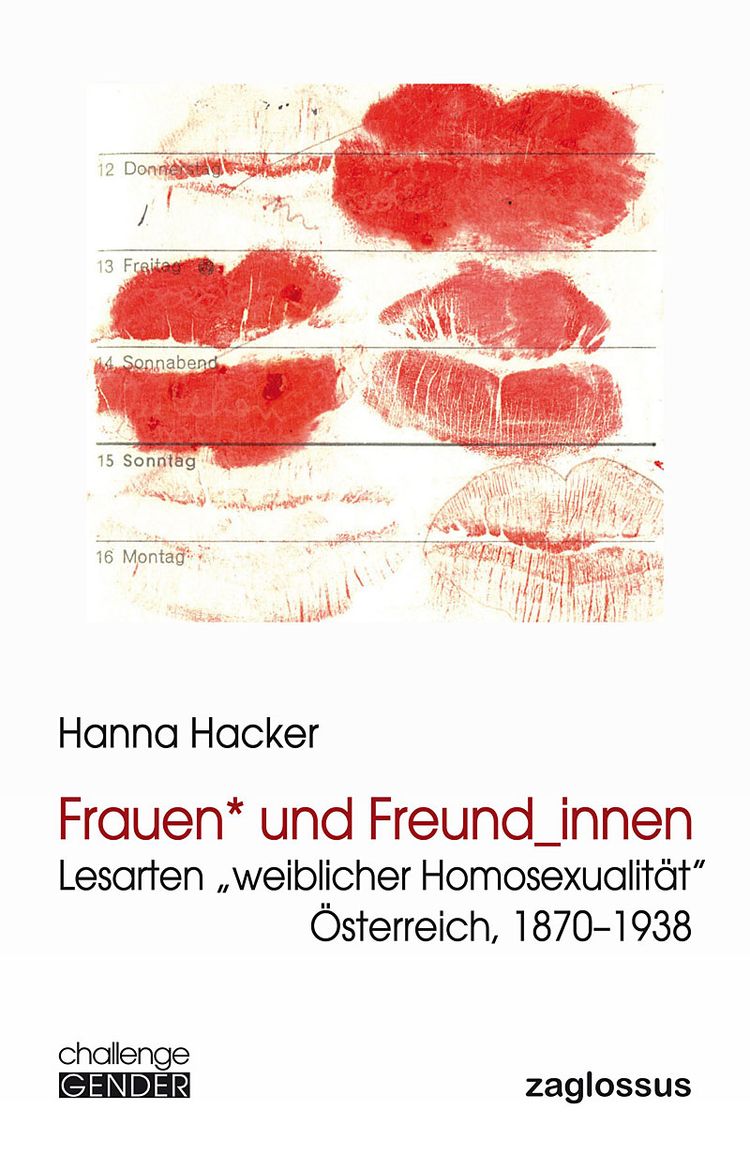STANDARD: Sie präsentierten diesen Donnerstag "Frauen* und Freund_innen. Lesarten 'weiblicher Homosexualität'", die überarbeitete Fassung Ihres eigenen Buches aus 1987. Warum die Neuauflage?
Hacker: Das Buch ist eine sehr umfassende Geschichte der Entstehung und Ausformung nichtnormativer, als "homosexuell" bezeichneter Identitäten. Es ist zugleich auch ein Stück innovative Theorie, es war 1987 eine Art PionierInnenwerk. Das Buch ist seit langem vergriffen.
STANDARD: Sie haben sich damals für den Zeitraum 1870 bis 1938 entschieden. Warum?
Hacker: Anfangs wollte ich mich auf die 1920er-Jahre konzentrieren. Dann aber entdeckte ich nach und nach das späte 19. Jahrhundert als einen ganz wesentlichen Zeitraum, in dem die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass es in den "Tollen Zwanzigerjahren" sichtbare und selbstbewusste lesbische Kultur gab. Homosexualität und Heterosexualität als, wie es damals hieß, "Charaktere" sind weitgehend eine Erfindung aus den späten 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Vielfach waren es männliche Wissenschafter, die an dieser Erfindung arbeiteten, teilweise als Reaktion auf die gleichzeitig entstehende Frauenbewegung und auch in Gleichzeitigkeit mit den neuen staatlichen Etablierungen, also etwa des Deutschen Kaiserreiches und der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Die NS-Machtergreifung in Deutschland 1933, der Austrofaschismus in Österreich ab 1934 und dann deutlich das Jahr 1938 können als Endpunkte dieser Geschichte gesehen werden.
STANDARD: Sie haben sich geografisch auf Österreich beschränkt, ihr Buch aber großteils in Berlin geschrieben. Wie kam es dazu?
Hacker: Geschrieben habe ich es schon überwiegend in Wien, aber die wesentlichen Impulse verdanke ich westdeutschen, konkret in West-Berlin tätigen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen. Ich habe dort die Überzeugung kennengelernt, dass es möglich ist, "Lesbengeschichte" zu schreiben. Viele Ansätze kamen aus den USA und waren in Österreich noch sehr lang nicht bekannt. In Westberlin gab es "Lesbenseminare" an der Uni und das erste große Lesbenarchiv, das heute "Spinnboden" heißt. Und ich durfte "alte" Lesben kennenlernen, die sich selbst noch zum Beispiel an die berühmten Damenbälle der Weimarer Republik erinnerten.
STANDARD: Was sind die größten Unterschiede zwischen Ihrem Forschungsansatz 1987 und Ihrem jetzigen?
Hacker: In den Anfängen "lesbischer" Historiografie ging es ja darum, argumentieren zu müssen, dass der eigene Forschungsgegenstand – frauen*liebende Frauen* in der Geschichte – überhaupt existiert. An der Wiener Uni verfügbare Doktorväter hatten genau diese Zweifel und äußerten sie auch mit entsprechender Herablassung. Stattdessen habe ich die Geschichte lesbischer Frauen als Geschichte "aller Frauen" definiert und begreifbar zu machen versucht. Gegenüber dieser Idee von "allen Frauen" bin ich heute mehr als distanziert. Ich würde sie mittlerweile als eurozentrisch kritisieren; ich bemühe mich aktuell viel deutlicher um eine intersektionelle Perspektive, also um ein Zusammendenken verschiedener sozialer Differenzen und Herrschaftsverhältnisse – es muss ausdrücklich auch um Fragen wie Rassismus gehen.
STANDARD: Wovon sprechen wir heute, wenn von "weiblicher Homosexualität" die Rede ist? Ist es noch adäquat, von "Lesben" zu sprechen?
Hacker: Ich denke, das "L" im aktuellen Akronym FLIT – Frauen Lesben Inter* Trans* – ist nicht mehr dasselbe L wie im Begriff "lesbisch" der 1970er-Jahre, als die Figur der "bewegten" Lesbe entstanden ist. Lesbisch ist kaum noch ein Alleinstellungsattribut, sozusagen. In vielen Biografien verflüssigen sich die sexuellen und geschlechtlichen Selbstbenennungen. Es wird sich nicht mehr so sehr auf eine einzige Bezeichnung festgelegt.
STANDARD: Ihr Postulat war es 1987, die Geschichte der "Erfindung" und Durchsetzung der Ordnungsbegriffe Homosexualität und Heterosexualität als Geschichte des gesamten Geschlechterverhältnisses zu erzählen. Ist dieser Ansatz heute, wo im queeren Diskurs schon von der "Genderpension" die Rede ist, und das x für die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit steht, nicht obsolet?
Hacker: Geschlechterdefinitionen sind ja nach wie vor sehr wirksam und politisch heißumkämpftes Terrain. Der ganze Begriff der "Heteronormativität" ist für den queeren Diskurs zentral; er ist aus dem älteren Konzept der Kritik an "Zwangsheterosexualität" hervorgegangen. Forschung zu Homosexualitäten und Heterosexualitäten im 19. und 20. Jahrhundert heißt unausweichlich, sich beispielsweise mit dem Konstrukt des "Dritten Geschlechts" oder der "sexuellen Zwischenstufen" auseinanderzusetzen, die jeweils sowohl eine emanzipatorische als auch eine disziplinierende, normierende Dimension hatten. Und da kommt man schon sehr nahe an queere und trans*politische Fragestellungen.
STANDARD: Die Ideologie der Zweigeschlechtlichkeit zu kritisieren war 1987 innovativ und verwirrend, ihr Buch, hervorgehend aus ihrer Dissertation, entstand noch vor Judith Butlers "Gender Trouble". Was hat sich im Diskurs geändert, und was erhoffen Sie sich davon für die Rezeption ihres Buchs?
Hacker: Judith Butler und Queer Theories stehen für ganz wichtige Innovationen im Denken zum Geschlecht. Trotzdem waren einige der Folgen für geschichtswissenschaftliches Arbeiten auch ein bisschen zwiespältig. Butlers Gendertheoreme, die als so ganz "neu" ankamen, wurden lange Zeit nicht übersetzt in eine genaue Auseinandersetzung mit historischen Quellen. Irgendwie gab es da ein Abreißen, ein Nicht-wieder-Anknüpfen an Forschungen und Neugierden aus der Zeit vor Queer. Ich wünsche mir, dass meine "Frauen* und Freund_innen" Möglichkeiten aufzeigen, zwischen angeblich älteren und neueren – und neuesten genderkritischen Sichtweisen zu vermitteln. Die Ähnlichkeiten und die Unterschiede genauer anzusehen.
STANDARD: Sie sprechen in Ihrem Buch vom "queer turn". Was bedeutet er für Sie, und welche Bedeutung hat er für Ihre Arbeit?
Hacker: Der "queer turn" in den Geistes- und Kulturwissenschaften wird als großer Umbruch im Verständnis von Geschlechtern und Sexualitäten angesehen; es geht unter anderem um ein tiefgreifendes Infragestellen von Weiblichkeits- und Männlichkeitskonzepten und um eine Kritik an der Ideologie von Zweigeschlechtlichkeit überhaupt. Queere Ansätze haben es mir tatsächlich leichter gemacht, konsequent über die Kategorien Männer und Frauen hinauszudenken.
STANDARD: Es gab 1987 zum Beispiel keine offen schwulen Bürgermeister, keine eingetragenen PartnerInnenschaften, keine weiblichen geouteten Popstars, kein Binnen-I – um nur einige Beispiele zu nennen. Heute ist das anders. Was bedeutet das für die historische Lesbenforschung? 1987 waren Sie noch ziemlich allein mit ihrem Thema in der österreichischen Sozial- und Kulturgeschichte. Ist es im Mainstream angekommen?
Hacker: Einem Mainstreaming stehe ich ohnedies eher skeptisch gegenüber. Gleichzeitig bekrittle ich immer wieder, dass es mit den queer-feministisch-lesbischen historischen Arbeiten nicht so umwerfend umfangreich und innovativ weitergegangen ist, wie ich es mir wünschen würde. Aber auf jeden Fall gibt es so etwas wie Forschungsfortschritte, Theoriefortschritte, vor allem auch eine eindrucksvolle Weiterentwicklung von Vermittlungspraxen, also beispielsweise Ausstellungen wie zuletzt "150 Jahre Homosexualität_en" in Berlin 2015. Im deutschsprachigen Raum haben sich zahlreiche Vernetzungsprojekte etabliert, Archive und Sammlungen. Das hinreißende Kussmund-Cover des Buches verdankt sich einem Objekt aus der Sammlung "Frauennachlässe" am Geschichte-Institut der Uni Wien. Queer-feministische Ansätze sind im Wissenschaftsbetrieb sichtbarer und hörbarer geworden, aber meine eigene Erfahrung ist, sie sind auch sehr prekär und verletzlich. (Tanja Paar, 13.1.2016)