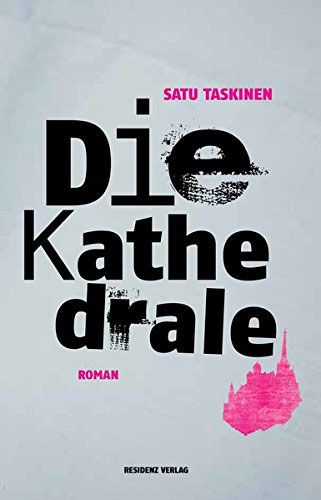Es genügt in unseren Breiten nicht, Dinge zu besitzen, es müssen auch die richtigen sein, und vor allem: Man muss sie rechtzeitig wieder wegwerfen. Das ist im Keim pervers und gleichzeitig so selbstverständlich, dass diejenigen, die diese Disziplin nicht beherrschen, bei ihrer Umgebung großes Unwohlsein wecken – ganz abgesehen davon, dass irgendwann der Platz ausgeht und sich das Ungeziefer einnistet.
Der zweite Roman der in Wien lebenden Finnin Satu Taskinen handelt von so jemandem: Tea sammelt alles, was ihr unterkommt, sie füllt ihre Altbauwohnung bis zum Anschlag. Sehr zum Missfallen ihrer Angehörigen. Tea, so lautet das meist unausgesprochene Urteil ihrer Geschwister, ihrer Mutter, ihres Exmannes, auch ihres erwachsenen Sohnes, sei lebensuntüchtig, habe die Kontrolle verloren.
Die Kathedrale umfasst ungefähr einen Tag und zeigt, von einem parabelartigen Prolog abgesehen, eine Innenansicht der Heldin. Anlass ist das Begräbnis der jüngsten Schwester, Kerstin, die schon jahrelang ein Pflegefall war; zur Trauerfeier kehrt Tea zum ersten Mal seit langem zurück in den Kreis der Familie. Deren stille Vorhaltungen, die unterschwellige Herablassung entgehen Tea nicht. Die Blicke der Familie, das wird klar, sind das Fegefeuer, in dem Verfehlungen abgebüßt werden.
Sammlungen entspringen dem Wunsch, der Vergangenheit habhaft zu werden, ein Stück der Wirklichkeit zu kontrollieren, Verlustängsten zu begegnen. Dazu dient auch das Gerümpel, das Teas Wohnung füllt, bis diese sich um Tea schließt wie ein Etui. Es sind der lange zurückliegende Verlust des Vaters und die schwere Krankheit der jüngsten Schwester sowie eine unklare Mitschuld an alldem, gegen die Tea die Dinge in Stellung bringt. Zugleich ist es dieses Gerümpel, das die Kluft zu ihrer verbliebenen Familie langsam unüberbrückbar, die Schuldgefühle der Heldin erdrückend werden lässt.
Die Kathedrale ist ein Schuld-Drama; die Gedankenketten der Heldin kreisen von Seite zu Seite immer dichter und immer schneller um eine Selbstanklage, ein in der Vergangenheit liegendes, schwer festzumachendes Vergehen und um eine diffuse Hoffnung auf Vergebung. Teas Sündenfall ist dabei nicht, wie man annehmen würde, die Habsucht, sondern die Verzweiflung.
Während sich vor dem Auge des Lesers in zunehmendem Furor ein Kampf um Erlösung und Verdammnis abspielt, ein Familiendrama als existenzielle Suche nach Absolution, ist zugleich klar, dass diese Absolution nicht mehr zu haben ist – weil Tea in den Augen der anderen nicht einmal mehr schuldfähig ist und weil, wie Tea selbst weiß, Schuld relativ ist oder zumindest niemand sagen kann, woran man sie vernünftigerweise misst.
Bei alldem zeigt die Autorin die Sammlung, um die es vermeintlich geht, nicht oder nicht ausführlich, lässt sie höchstens nebenbei ins Bild treten. An die Stelle der Sammlung tritt die Sprache. Es ist Teas Monolog, der überquillt, in dem keine Lücke geduldet wird: Sie denkt an das Essen, an die Pelargonien, die Kindheit, den Vater, den Hausmeister; nummeriert im Geiste die Trauergäste, bemängelt das Buffet, verflucht ihre Schuhe, all das bei zunehmendem Leidensdruck.
Immer wieder sortiert sie ihre Familie neu, eine Beschwörung, um die klaffenden Lücken in ihrem Umfeld zum Verschwinden zu bringen und sich selbst in den Kreis der Familie zu integrieren: "Dem Alter nach waren wir Vater, Ilse, Bea, Leo, ich, Kerstin und Mark", so heißt es zu Beginn, und später, bei fortschreitender Zerrüttung: "Wir waren nur noch Ilse, Bea, Leo, Simon, ich und Mark. Von uns starb ich als Erste."
Ebenfalls im Residenz-Verlag erschien mit Evelyn Grills Der Sammler vor einiger Zeit schon einmal ein Roman um einen zwanghaften Sammler und die, die sich seiner annehmen; ein sehr lesenswertes, bitterböses Stück Literatur auf engstem Raum, in dem die Wohlmeinenden um einen Tisch sitzen und sich bis zum Schluss allesamt als Scheusale entlarven.
Taskinens Roman dagegen ist weniger pointiert, vorsichtiger. An keiner Stelle verrät sie ihre Figuren: Die Familie ist immer Fegefeuer und Nestwärme zugleich; Tea ist stets eine kluge und gewitzte Beobachterin. Ihren Gedankengängen zu folgen ist bei allem inneren Elend immer wieder erhellend und sehr unterhaltsam.
"Der Inhalt meines Gehirns breitet sich wie von selbst aus, er ordnet sich beständig um. Ich finde dieses wogende Meer ja auf keinen Fall richtig oder gut", so die Heldin; dass man hingegen als Leser aus ihrer Seelenpein sehr wohl ästhetischen Genuss ziehen kann, und keinen geringen, zeugt vielleicht von der latenten Unmoral der Literatur, sicher aber vom Können der Autorin.
Über den Einzelfall hinaus weisen in dieser Fabel von der verzweifelten Sammlerin Spuren in Richtung einer gesamtgesellschaftlichen Katastrophe, einer überindividuellen Schuld; aber diese Spuren bleiben vieldeutig. Tea und ihre beunruhigende Sammlung lassen sich nicht in einem größeren Zusammenhang auflösen. Auch das gibt dem Text sein Gewicht. So erleichternd es wäre, Taskinens Sammlerin ist kein Exempel; der Leser bleibt, wie die Heldin, unerlöst. (Bernhard Oberreither, Album, 16.7.2016)