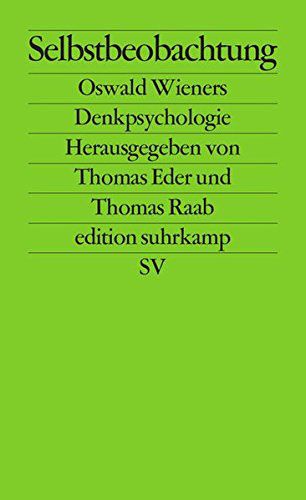Die Geschichte der Psychologie und der Epistemologie wird gerne von Descartes aus erzählt. Dessen Meditationen (1641) beschreiben bekanntlich die verschiedenen Schritte eines Prozesses der Selbstkenntnis, welcher mit der berühmten Prämisse "cogito ergo sum" einsetzt. Zwar wird "cogito" normalerweise als "ich denke" übersetzt, doch ging es Descartes um jeden bewussten Wahrnehmungszustand.
Bei der Suche in der Vorratskammer seines Bewusstseins stieß Descartes nun auf alles Mögliche: auf logische Regeln, deutlich umrissene Konzepte wie auch auf viel Bildhaftes – genügend Elemente jedenfalls, um aus ihnen die ganze äußere Welt mitsamt ihren physikalischen Gesetzen ableiten zu können.
Psychologie wie Epistemologie haben sich seit Descartes mit dem Grundproblem herumgeschlagen, dass objektiv-wissenschaftliche Kenntnis allgemein zugänglich sein muss, Bewusstseinszustände aber ausschließlich privater Natur sind. Der Arzt kann zwar den Blutdruck messen, doch die Frage "Wie geht es Ihnen?" kann bloß derjenige beantworten, dem die Frage gestellt wird. Er allein hat Zugang zu seinem Befinden.
Als sich die Psychologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eigenständige wissenschaftliche Disziplin festigte, wurde die Selbstbeobachtung gemeinhin als unabdingbare Notwendigkeit betrachtet. Allerdings wurde zwischen verschiedenen Schulen ein lebhafter Methodenstreit darüber geführt, mit welchen Mitteln diese Selbstbeobachtung ausgeführt werden musste und welche Elemente man dabei entdecken konnte.
Da war das allgemeine Problem der Unüberprüfbarkeit von rapportierten Selbstbeobachtungen; die Schwierigkeit, die letzten Elementarteile von Denkabläufen zu benennen; und die auf simple Muster beschränkten Möglichkeiten, Wahrnehmung und Physiologie aneinanderzukoppeln. Die gleichzeitigen Erfolge von Reflex- und Konditionierungsstudien (man denke an den geifernden Hund von Pawlow) führten schließlich zu einer Kehrtwende und zum Triumph der Behavioristen.
Das berühmte Manifesto von J. B. Watson (1913) beginnt mit den Worten: "Für den Behavioristen ist die Psychologie ein völlig objektiver, experimenteller Zweig der Naturwissenschaft. Ihr theoretisches Ziel ist die Voraussage und Kontrolle von Verhalten. Introspektion spielt keine wesentliche Rolle in ihren Methoden."
Das Bewusstsein und die Überprüfung seiner Inhalte verschwanden in der Folge weitgehend aus der Psychologie. Diese Situation hat sich in den letzten Jahren insofern geändert, als neue technologische Möglichkeiten, wie zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomografie, es der Psychologie erlauben, für gewisse Gehirnaktivitäten die gleiche objektive Zugänglichkeit zu erzeugen, die im Zeitalter des Behaviorismus den äußeren Verhaltensmustern vorbehalten war.
Insofern ist man neuerdings zu einer Korrelation von Physiologie und Bewusstseinsinhalten zurückgekehrt, wie sie – wenn auch mit anderen Mitteln – auch in der Anfangszeit der experimentellen Psychologie praktiziert worden ist. Nicht zurückgekehrt in die akademische Psychologie ist jedoch die Beobachtung der Denkverläufe und Bewusstseinsinhalte selbst. Techniken der Selbstbeobachtung, wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt worden sind, finden wir im Arsenal der heutigen Psychologie nicht.
Eine faszinierende Ausnahme zu der geschilderten Entwicklungslinie bilden die Exerzitien des österreichischen Alleskönners Oswald Wiener, der lebenslang vor sich selbst auf der Lauer gelegen ist, um seinen eigenen Denkstrukturen auf die Schliche zu kommen. Ein gewisses Maß an Selbstbeobachtung ist bereits in seinem Roman die verbesserung von mitteleuropa (1969) erkennbar, wo das undurchsichtige Verhältnis von mentalem Zustand, Sprache und Handlung verschiedentlich, zumeist aphoristisch, thematisiert wird.
Seine Erfahrungen als Musiker haben sich zudem in Gedanken zum Wahrnehmen von Rhythmus und zur Improvisation niedergeschlagen, seiner Arbeit als Informatiker verdanken wir verschiedene, von der Kybernetik beeinflusste Reflexionen zur Funktionalität von Bewusstseinszuständen. In seiner Zeit als Professor für Ästhetik an der Kunstakademie Düsseldorf (1992-2004) hat sich Wieners Interesse an der Struktur von Bewusstsein und Denken schließlich verwissenschaftlicht.
In Vergessenheit geratene psychologische Forschungsansätze aus dem frühen 20. Jahrhundert erneut aufgreifend, hat Wiener seine Studien zur Epistemologie, zur Ästhetik und zu den Strukturen des menschlichen Bewusstseins mit Selbstbeobachtungstechniken angereichert. In Düsseldorf wie auch in Österreich, wohin Wiener vor ein paar Jahren zurückgekehrt ist, hat er zudem Weggefährten gefunden, die sowohl seine Fragestellungen wie auch seine Methoden übernommen haben, weiterentwickeln und mit der akademischen Psychologie zu verknüpfen suchen.
Ausgehend von drei Symposien in Mürzzuschlag (2009-2011) hat diese Gruppe ihre Ergebnisse in einem stattlichen "Arbeitsbuch" gebündelt. Was hier vorliegt, erweckt den Eindruck einer Pionierarbeit: Obschon terminologisch und methodologisch noch nicht völlig auskristallisiert, sind die Ergebnisse von wissenschaftlichem Wert. Wiener und seine Weggenossen wenden die Selbstbeobachtung vornehmlich auf zwei Situationen an, nämlich die Lösung von komplexen Denkaufgaben (häufig geometrischer Art) und das freie, assoziative Denken.
Auch wenn Selbstbeobachtung eine beinah paradoxe Art der Bewusstseinsverdoppelung erfordert; auch wenn sie selten mehr als eine Minute lang ausgeführt werden kann; auch wenn sie den methodologischen Nachteil hat, dass die Berichterstattung über das Beobachtete zuletzt doch wieder in Worte und Zeichnungen gefasst werden muss – trotz all dieser Beschränkungen sind die vorgelegten Ergebnisse für die Psychologie und Neurowissenschaft wichtig. Denn es erweist sich mit großer Deutlichkeit, dass unsere Alltagssprache eine falsche Vorstellung von unserem "Denken" generiert.
Unser Denken kann nämlich weder auf Ideen, Sprache oder Bilder reduziert werden; diese sind zwar allesamt involviert, doch sind sie dies immerzu auf eine ephemere, bloß aufblitzende Art und Weise. Was in unser Bewusstsein tritt, ist zumeist zielgerichtet, lösungsorientiert, und bei der Suche nach Lösungen und Orientierung werden uns heterogene Elemente zugeworfen, die aus verschiedenen, für uns unzugänglichen Domänen stammen.
Ob das von Wiener und seinen Mitstreitern erarbeitete neue Glossar für diese Elemente in die akademische Psychologie oder Kognitionswissenschaft Eingang finden wird, wird sich noch weisen. Unbestreitbar jedenfalls ist die Notwendigkeit einer neuen Terminologie selbst. Eine der interessantesten Fragestellungen der psychologischen Neurowissenschaften ist die, ob es ihr je gelingen wird, umgangssprachliche Ausdrucksweisen wie "mit Gewissheit wissen, dass x", "sich für y entscheiden" oder "sich auf z freuen" als bestimmte neuronale Zustände zu beschreiben respektive Erstere durch Letztere zu ersetzen.
Die von Wiener und seinen jüngeren Kollegen betriebene Selbstbeobachtung zeigt jedoch, dass das Problem noch viel verzwickter ist: Es geht nicht bloß um die Korrelation von inneren Kategorien ("wissen", "traurig sein") und Gehirnzuständen, sondern eigentlich noch viel eher um die Korrelation unserer idealisierenden, jedoch falschen Alltagsvorstellungen von der Art, wie wir denken, fühlen und entscheiden, mit den wirklichen Abläufen, die man, obschon sie Tag und Nacht in uns ablaufen, offensichtlich bloß mit Mühe erkennt.
Um das eigene Bewusstsein auf frischer Tat zu ertappen, muss man ein veritables Training absolvieren. Die Protokolle von Wiener und seinen Kollegen erzählen von dem, was man dabei so alles in sich entdecken kann – und inwieweit man sich dennoch unbegreiflich bleibt. (Christoph Lüthy, Album, 24.12.2016)