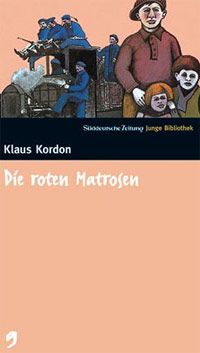
Die Buben sollten ausrechnen, wie viele Mark die U 9 mit drei Schüssen vernichtet hat, als sie drei englische Panzerkreuzer in den Grund bohrte. Immer nur die Verluste der anderen, findet aber der dreizehnjährige Helle, nie die der eigenen Truppen. Dabei haben von den dreiundzwanzig Buben in Helles Klasse schon neun ihren Vater verloren, zwei sind Krüppel, einer sitzt im Gefängnis, weil er gegen den Krieg gestreikt hatte.
Helles Vater gehört zu den zwei Krüppeln. Er ist wenige Tage zuvor von der Front zurückgekehrt, zum letzten Mal, mit diesem seltsam leeren Ärmel. Der Stumpf wackelt komisch hin und her, weil die Ärzte den zersplitterten Knochen entfernen mussten, und Helle mag am Anfang gar nicht hinsehen. Doch der Vater zwingt ihn dazu. Immer wegschauen bringt nichts, sagt er.
Hinschauen tut auch Klaus Kordon, und zwar ganz genau. Mit Akribie zeichnet er die Ereignisse der letzten Kriegswochen und der Revolution von 1918 nach, ein unbestechlicher Chronist der Geschichte kleiner Leute. Die roten Matrosen sind der erste und packendste Teil der Trilogie über die Arbeiterfamilie Gebhardt, die er mit Mit dem Rücken zur Wand (die Jahre 1932/33) und Der erste Frühling (1945) fortgesetzt hat.
Kordon erzählt lebendig die Geschichten hinter der Geschichte, für Jugendliche. Seine jungen Leser verschont er nicht, und deshalb fühlen sie sich ernst genommen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich im Berliner Arbeiterbezirk Wedding, dass in Kiel die Matrosen streiken. Helles Vater schließt sich den Spartakisten an, die am 9. November 1919 Arbeiter und Soldaten zum Generalstreik aufrufen, um den Kaiser zum Rücktritt zu zwingen. Ihnen schwebt freilich eine andere Regierung vor als die unter dem Reichskanzler Friedrich Ebert.
Dass die Unabhängigen "auf Ebert reingefallen sind", wie Helles Vater sagt, zieht sich wie ein tiefer Riss durch das vierte Hinterhaus der Ackermannstr. 37, so tief wie der Bruderzwist unter den Sozialisten. Noch tiefer verlaufen die Gräben zwischen den Kaisertreuen und den Sozialdemokraten, etwa den Lehrern Förster und Flechsig, von denen der eine seine Schüler mit dem Rohrstock maßregelt und der andere sie politisch aufklärt.