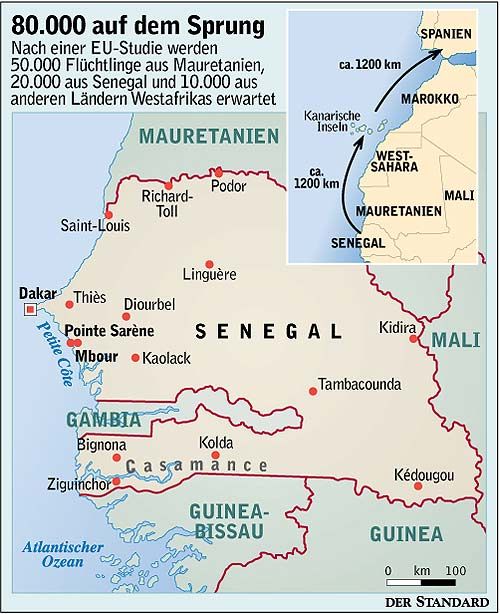Bleigrau und warm schlägt der Ozean an den Strand von Pointe Sarène. 550 bis 800 Euro soll die Überfahrt in einem einfachen Fischerboot kosten, die Atlantikküste hinauf bis zu den Kanarischen Inseln. Eine solche Himmelfahrt macht keinen Sinn in Pointe Sarène, einem Fischer- und Urlauberdorf an der "kleinen Küste". "Wir haben die Produktion verdoppelt, wir können Geld auf die Seite legen", sagt eine der Fischerfrauen, die das Dorf nun im Griff haben. "Vor Kurzem haben wir sogar unseren Männern Kredit gegeben, eine Million Franc CFA (1570 Euro), damit sie sich Treibstoff für die Boote kaufen können."
Die Bank im Dorf
Das sagen die Frauen von Pointe Sarène über ihre Ehemänner, die Fischer, lachen dabei und klatschen vor Vergnügen in die Hände. Ringsum liegt der Fisch auf Trockengittern und stinkt. "Yet" und "gedj", so heißt er auf Wolof, der Hauptsprache im Senegal, wird fermentiert, gesalzen, getrocknet und dann weiter verkauft. So viel Geld ist mittlerweile im Umlauf, dass eine Kasse im Dorf gebaut werden muss, die kurzfristige Kredite an die geschäftstüchtigen Frauen auszahlt und Einnahmen entgegennimmt. Es wird wohl eine der letzten Investitionen sein, die Österreichs Entwicklungshilfebehörde (ADA) in Pointe Sarène tätigt.
Für die Hälfte des kleinen Bankgebäudes haben die Frauen ohnehin zusammengelegt – sie wollen einen Saal, in dem sie sich treffen und ihre Geschäfte besprechen können. Seit sich die 240 Frauen vor fünf Jahren zunächst zu einer Vereinigung zusammenschlossen und später, als Planung und Verwaltung immer aufwändiger wurden, einer der landwirtschaftlichen Kooperativen beitraten, die Österreich im Senegal organisiert, stieg der Verkaufspreis für den verarbeiteten Fisch aus Pointe Sarène. Zwischen 650 und 1200 Franc CFA das Kilo (etwa ein bis 1,90 Euro) wird nun gezahlt, und ohne jene Zwischenhändlerinnen, den "Grandes Dames", die den "kleinen" Fischerfrauen im Dorf zu hohen Zinsen Geld ausliehen, um den angelandeten Fisch zu kaufen.
Zwei Prozent Zinsen sind es dagegen in den Kooperativen, vier großen Projekten im Norden Senegals und um die Hauptstadt Dakar, die mittlerweile 370.000 Bauern, Fischer und deren Familien ernähren und welche die ADA nun auf die abgeschnittene, instabile Region der Casamance ausdehnen will.
Von den alten, ursprünglich sozialistischen Landwirtschaftskooperativen des senegalesischen Staates will dagegen niemand mehr hören. "Die gibt es nur noch auf dem Papier", sagen die Bauern in Mbour, am Sitz der Genossenschaft, zu der auch die Fischerfrauen von Pointe Sarène gehören. Dünger und Saatgut seien schlecht gewesen, die Lieferungen unzuverlässig, der Zugang zu Krediten bei den Banken war – wie heute noch – schwierig. "Wir haben den Gürtel eng geschnallt und sind hungrig auf die Felder gegangen", erzählt Mahamadou Cissé, der alte Chef der Genossenschaft.
Die Jungen vom Land
Eine Tonne Hirse könne er jetzt auf seinem Feld ernten, gerade einmal 350 Kilo waren es früher, sagt Cissé. Organisiert vom Leiter des österreichischen Projekts, einem Agrarökonomen und früheren UN-Beamten, wurden Dünger und Saatgut in den vergangenen Jahren getestet und verbessert, neues Zuchtvieh wurde eingeführt. Ähnlich wie im Fischerdorf Pointe Sarène, einige Kilometer weiter, werden Ernte und Produkte bei der Genossenschaft eingelagert. Damit umschiffen die Bauern je nach Saison die Einbrüche bei den Marktpreisen. "Wir hoffen, dass nun auch die Jungen auf dem Land bleiben", sagt einer der Bauern.