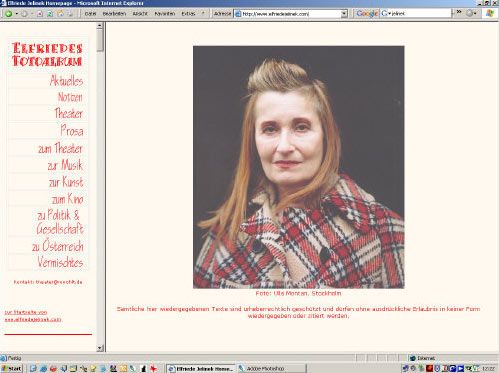
Zahlreiche Texte und Notizen der Nobelpreisträgerin zu diversen Themen: elfriedejelinek.com
Und diese Doppeldeutigkeit wird im Schreiben beherrscht, ironisch vor einem Ringelspiel mit "Topferln" inszeniert. Nur wenig später schließt der Text: "Ich sollte gemeistert werden. Ich sollte nicht Maschinen mit mir bestücken und damit eine Art Herrschaft über sie erlangen. Da hätte ich ja etwas über Herrschaft lernen können, und das war nicht erlaubt. Der einem fremden Willen Unterworfene treibt, wie Stückgut, Papierln, Äste, am Wesen des Lebens vorbei. Der Prater hätte nichts als ein Kescher sein können, der einen hätte herausholen können."
"Bestücken": Wer an Vergnügungsmaschinen Herrschaft erfahren will, sagt das Wort, muss Teil von ihnen werden und gibt seine Menschlichkeit preis. Andererseits treibt auch das unterworfene Kind im Willen der Mutter als "Stückgut". Und wieder ist diese Wörtlichkeit im Text genau in Szene gesetzt: Im üblichen Wortsinn wird die Rinne "bestückt", in welcher im Vergnügungspark dann jene Plastikentchen treiben, die mit dem Kescher gefangen werden.
Die Schwingung
Ein Kritiker muss viele Worte machen, um hervorzuheben, wie Texte Elfriede Jelineks auf ihrer eigenen Wörtlichkeit bestehen - dabei ist das ihre einfachste, beim Lesen ganz offensichtliche Qualität. "Das Gefüge einer Seite guter Prosa ist, logisch analysiert, nichts Starres, sondern das Schwingen einer Brücke, das sich ändert, je weiter der Schritt gelangt" (Musil). Ein Kritiker aber, der dem nachgeht, droht, sich lächerlich zu machen: Er verliert die Herrschaft über den so besprochenen Text. Der Text ist ihm, der so angestrengt den Sinn einzelner Worte fixiert, immer schon an Dichte und um die Schwingung einiger scheinbar leicht hingeworfener Wörter voraus.
Vielleicht werfen deshalb professionelle Kritiker Elfriede Jelinek mitunter vor, sie könne nicht "erzählen". Denn "Erzählungen", so glaubt diese Kritik, beherrschen ihre Wortwahl ganz anders: Sie würden nicht die Bedeutung von Wörtern entfalten, sondern sie in einem Rahmen fixieren, um den fiktiven Gegenstand dingfest zu machen. Um erzählen zu können, müsse das Denken den Spielraum der Wörter begrenzen. Die "Erzählung" wäre gleichsam Ausdruck eines Außerhalb der Sprache und keines Innerhalb, das Wörtern nachdenkt.
Diese Position ist naiv, wenn Sprache wie ein Unterbewusstes funktioniert, das sich nicht einfach durch das Denken beherrschen lässt. Der Spielraum aber, den Jelinek ihren Wörtern gibt, ist nirgendwo leichter zu begreifen als auf ihrer Homepage www.elfriedejelinek.com.
Eine Annäherung
Die Kürze und Vielfalt der hier veröffentlichten Texte verführt und zwingt dazu, sich immer neu einzustellen. Außerdem schattet das Internet als Ort der Lektüre ein Vorverständnis dessen, was vom Text "gewollt" ist, tendenziell ab: Die chronologische Ordnung, der Titel zum Öffnen des Textes haben nur grob orientiert. Wie im Akademietheater zuletzt in Jelineks Babel sitzt man gleichsam im Dunkel, abgetrennt vom üblichen Lesetheater, und hört eine Stimme, die ihren Ton sucht. Dann wundert man sich, was "es" ist: "Es" könnte eine Annäherung an Bilder, zum Beispiel an die Fotographien Einar Schleefs sein; oder eine an die Selbstsicherheit, mit der Günther Grass seine Zwiebel häutet; oder "es" ist doch die Stimme Moosbruggers, des Lustmörders aus Musils Roman, der mit seiner Öffentlichkeit kokettiert.
Das Begehren
Indem dieses "Es" den Wörtern ihr Spiel einräumt, erzählt es vom Zusammenhang von Sprache, Begehren und Herrschaft. Thematisch vordergründig wird das unter anderem in zwei der jüngsten Texte auf der Homepage aus einem Opernprojekt mit der Komponistin Olga Neuwirth.
In ihrem Requiem auf eine Oper erklärt Jelinek, wie ihr Libretto auf Kierkegaard antwortet, der am Beispiel von Mozarts Don Giovanni das Begehren analysiert. Und eine Skizze zum Libretto führt vor, wie sie diese Vorlage am Fall des Kinderschänders W. entromantisiert und bricht. "Schwärmerische Bewunderung kann natürlich unnatürlich werden, das ist klar, ob zu einem Wagen oder zu einem Menschen, das ist egal."
Nun sind nicht nur Texte Jelineks unheimlich, die den Schrecken so offenkundig zum Thema haben: "Das Unheimliche", so definierte es Freud, sei "jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht." "Unheimlich" in diesem Sinne ist der sprachliche Zusammenhang, in dem das "Schreckhafte" bei Jelinek ja immer schon als Altbekanntes daherkommt. Unheimlich ist aber auch, wie vollkommen ihr scheinbar "rein sprachliches" Wortspiel die vertrauten Fakten des Kriminalfalls beschreibt.