In seinem Gastkommentar schreibt der Historiker Berthold Molden über die Gefahren der Normalitätsdebatte.
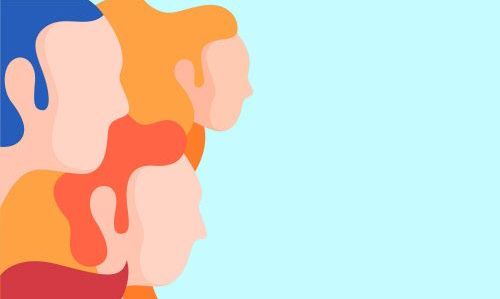
Unsere Großmutter selig pflegte kopfschüttelnd angesichts des aus ihrer Sicht exzentrischen bis unanständigen Verhaltens ihrer Familie zu sagen: "Ich bin der einzig normale Mensch!" Dann fiel meist die Tür hinter der geliebten alten Dame ins Schloss und alle Zurückgebliebenen lächelten einander an, im vollen Bewusstsein, selbst im Recht zu sein. Worum auch immer es gerade gegangen war. Denn Omas Normalität war uns nicht mehr als ein veraltetes Sittenbild, das unser Verhalten nicht zu fassen vermochte.
Dabei enthielt ihre Bemerkung den Kern jener Begriffsparadoxie, die dieser Tage die lebensgefährliche Heimatbühne unserer Bundespolitik beschäftigt. Großmutter nahm ganz selbstverständlich für sich in Anspruch, die einzige Verkörperung einer allgemeinen Norm anständigen Lebens und vernünftigen Denkens zu sein. Ihr gegenüber stand eine von unverständlich gewordenen Jungen aufgewühlte Welt ohne Ordnung, in der die Nacht zum Tag gemacht wurde und Haarlänge keine verbindliche Auskunft über Geschlechtszugehörigkeit mehr gab.
Verlorener Posten
In ihrer Aussage gerinnt das Spannungsverhältnis zwischen der Einsamkeit der aufrecht Sittsamen und der Behauptung einer Mehrheit, von der die Norm ausgehe, zum Bonmot. Witzig war die Situation, weil unsere Großmutter auf verlorenem Posten stand. Sie war in der Tat allein, ihre Norm hatte keine Verbindlichkeit mehr. Weniger heiter ist das Ganze, wenn einflussreiche Wortführerinnen den Begriff gebrauchen, um die eigene politische Linie als reinen Ton und die Aussagen Andersdenkender als Missklänge oder allenfalls bedeutungslose Interferenzgeräusche zu definieren.
"Das Ziel der Normalitätsrhetorik ist, die eigene Vorstellung von der Welt zum Gesetz für alle zu machen."
Die rhetorische Taktik ist bekanntlich recht simpel. Führer X oder Gouverneurin Y spannen ein fiktives Netz des Normdenkens zwischen zwei oder drei durch Umfragen und Posting-Verhalten verbrieften Knotenpunkten populären Unmuts: "Klimakleber sind linksradikale Chaoten!" zum Beispiel, "Migration = Umvolkung", "queer = krank" oder "Marxismus = Massenmord". Die politische Wortwahl, die sich aus vermutetem Volkszorn speisend zur Leitrhetorik emporschwingen will (und es mitunter leider tut), fällt dabei meist nicht auf solch radikale Formulierungen. Mit Rücksicht auf die Mitte, die man als Verteidiger des Hausverstandes ja einzunehmen behauptet, setzen die Normalisierer meist auf sanftere, ironische Varianten, wenn auch mit begründeter Hoffnung, dass die Anspielung so eines Volkskanzlers vom Zielpublikum schon richtig entschlüsselt werde.
Zorniger Hausverstand
In der Figur des "Volkskanzlers" oder der gnädigen "Landeskaiserin" (pardon, Frau Landeskaiser) wird, von Gott oder dem völkischen Schicksal geleitet, der zornige Hausverstand zur Essenz: "Die Norm bin ich. Meine Wut geht vom Volke aus." Meinungen wie die meiner Großmutter werden in jene zunächst nur propagierte, gegebenenfalls aber in Kraft tretende Norm geformt, welche die Politikerin zum Programm macht. Die erste, vom Wortstamm ausgehende Definition, die der Duden zu "normal" anbietet, lautet: vorschriftsmäßig. Demzufolge ist das Ziel der Normalitätsrhetorik, die eigene Vorstellung von der Welt zum Gesetz für alle zu machen.
Und darin liegt ihre gefährliche Kraft. Sie dient als Projektionsfläche für Menschen, die mit anderen Ansichten nicht zurechtkommen. La norme, c’est moi. Alle sollen so sein wie ich, der einzig normale Mensch. Wenn dieser Plan aufgeht, dann schlägt die Stunde der Blockwarte und Denunzianten, und es wird ungemütlich für die vielen, deren Lebensweise oder Meinung abzuweichen wagt. Dass die Normalisiererparteien dabei so normalen, sich mit der sozioökonomischen Mitte bescheidenden Figuren wie dem Finanzjongleur René Benko oder dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán nahestehen, wird dann kaum noch als Widerspruch erwähnt werden. (Berthold Molden, 5.8.223)