
Von heute aus gesehen, wirkt das Jahr 2015 weit weg. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass bald eine mehrjährige Pandemie die Welt vollkommen und mit unabsehbaren Folgen aus dem Rhythmus bringen könnte? Wer hätte daran gedacht, dass bald wieder Krieg in Europa herrschen würde, ein Krieg mit Atommächten, der sich auf das gesamte Weltgefüge auswirkt? 2015 erreichten bis dahin ungekannte Flüchtlingsströme die Europäische Union, aber noch herrschte eine Willkommenskultur, eine riesige Hilfsbereitschaft.
Drei Minuten vor zwölf
Angela Merkel meinte: "Wir schaffen das." Sie, die Endloskanzlerin, ist nun von der Bildfläche verschwunden. Sebastian Kurz war 2015 österreichischer Außenminister einer großen Koalition, noch hatte er sich nicht ins Kanzleramt gemobbt, noch war eine erneute schwarz-blaue Regierung bloß ein Schreckgespenst. Noch unvorstellbarer schien, dass Donald Trump jemals nicht nur Celebrity, sondern US-Präsident sein könnte. Greta Thunberg war 2015 zwölf Jahre alt, und auch wenn vielen die Fakten zum noch "globale Erderwärmung" genannten Klimakollaps geläufig waren und die Klimakonferenz in Paris das 1,5-Grad-Ziel ausrief, das heute als unerreichbar gilt, spielte diese größte menschenverursachte Katastrophe unserer Epoche noch keine Rolle im breiten Gesellschaftsbewusstsein.
Es würde noch Jahre dauern, bis Fridays for Future auf die Straßen traten. Vorerst war Europa schockiert über den Terroranschlag auf die Charlie-Hebdo-Redaktion. 2015 war ein Jahr, in dem sich jede Menge Unheil zusammenbraute, teils in epochalen Bildern, teils von der Öffentlichkeit unbemerkt. Die offizielle Weltuntergangsuhr stand auf "drei Minuten vor zwölf", nicht auf "neunzig Sekunden vor zwölf" wie heute.
Zeit des Umbruchs
Im Herbst 2015 saß ich mit einem meiner besten Freunde, dem Halbjapaner Carl Tokujiro Mirwald, in einem bayrisch-japanischen Trinklokal im Münchner Stadtteil Haidhausen, und er erzählte mir von einer Epoche, in der noch mehr Unruhe geherrscht zu haben schien als jetzt: der in Japan als Taishô Romantica und Taishô Demokratie bezeichneten Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Leidenschaftlich erzählte er mir von dem Anarchisten Sakae Ōsugi und der radikalen Feministin Noe Itô, die damals gegen die Unterdrückung aufgestanden waren. Sie waren für Carl Held(inn)en wie sonst nur der von ihm verehrte Bob Dylan, von dem er seit Jahrzehnten jedes Konzert im Umkreis von 500 Kilometern besuchte. Carl, der seit den Neunzigerjahren in Deutschland wohnte, reiste zweimal jährlich zurück in seine Heimatstadt Tokio. Oft hatte ich ihn dabei begleitet, und wir hatten mit unserem gemeinsamen Musikprojekt Shinto Konzerte in ganz Japan gegeben.

Der Taishō-Kaiser
Nach den Tourneen suchte Carl stets einen kleinen, mitten im Gewimmel Shinjukus versteckten Buchladen auf und füllte einen Koffer, den er extra zu diesem Zweck mitgebracht hatte, randvoll mit neuen wie antiquarischen japanischen Büchern, neben Belletristik großteils historisch wissenschaftliche und linkspolitische Schriften.
Carl, der bei jeder U-Bahn-Fahrt ein Buch zur Hand nimmt, gab acht, dass ihm in Europa der Lesestoff nicht ausging – denn mit wenigen Ausnahmen liest er ausschließlich japanische Literatur. Im Keller seines Münchner Wohnhauses wuchs ein wertvolles dokumentarisches Archiv heran, insbesondere über diese haarsträubende Taishō-Epoche der japanischen Geschichte. Der Taishō-Kaiser, der von 1912 bis 1921 regierte, hatte, auch aufgrund einer angeborenen neurologischen Krankheit, eine andere Vorstellung vom Regieren als seine Vorgänger. Er war kein autoritärer Herrscher, wie Japan es gewohnt war. Unter seiner Regentschaft gediehen neuartige Ideen. Demokratisch-liberale, emanzipatorische und künstlerisch avantgardistische Visionen machten die Runde, Einflüsse sowohl aus dem Westen als auch aus dem Christentum, kommunistische, selbst anarchistische Ideologien machten plötzlich der starren, unantastbaren japanischen Erbmonarchie zu schaffen.
Das Militär und der Polizeiapparat hatten alle Hände voll zu tun, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Dem Armeeoffizier Amakasu wurde die Aufgabe zugeteilt, sich um den Aufrührer Ōsugi und dessen sich rasch ausbreitendes, antinationales Umfeld zu kümmern. Ein Antiterrorgesetz wurde verabschiedet, das der Polizei vereinfachte, jede Opposition ins Gefängnis zu stecken und mundtot zu machen. Der Reihe nach verschwanden die Andersdenkenden in Kerkern und Todeszellen, dennoch entwickelte sich ein jahrelanger, verbissen geführter Freiheitskampf.
Das große Kantō-Erdbeben
Erst das große Kantō-Erdbeben 1923, das bis heute verheerendste der japanischen Geschichte, das Tokio zu weiten Teilen in Schutt und Asche legte, erst eine Naturkatastrophe solchen Ausmaßes bot der Geheimpolizei die Möglichkeit, umfassend gegen ihre Widersacher vorzugehen. Im Schatten dieser Katastrophe entwickelte sich die wahre Tragödie.
Ich war gebannt von Carls Berichten. Ich hatte nichts von diesen Geschehnissen gewusst, und doch erinnerten sie mich an das Ringen, das im Hier und Jetzt ausgetragen wurde, hundert Jahre später auf einem anderen Kontinent. Über immer mehr skurrile historische Figuren trug Carl Informationen zusammen. Ich lernte von feministischen Journalistinnen, die aus Eifersucht selbst vor Mord nicht zurückschreckten, von radikalisierten Anhängern, die blutige Rache schworen, von Müttern, die aus Verzweiflung ihre Neugeborenen im Fluss ertränkten. Mehr und mehr erfuhr ich über diesen außergewöhnlichen Kaiser, der sich heimlich unters Volk mischte und sich mehr der Lyrik als der Leitung seines Staates verschrieb.

Radikale Abschiede
Ich entdeckte einen angesehenen, wohlhabenden japanischen Autor, der mit seiner Freundin den Doppelselbstmord wählte und seinen gesamten Besitz der Arbeiterklasse vermachte. Fasziniert folgte ich der Biografie eines Tokioter Englischlehrers, der aus antimaterialistischer Überzeugung seinen Job an den Nagel hängte, sich für den kompletten Verzicht als einzige Lebensform entschied und daraufhin verhungerte. Und ich las den Abschiedsbrief einer politischen Aktivistin, die als Terroristin hingerichtet wurde. "Meine zwanzigjährige Seele hinterlasse ich denen, die hundert Jahre später nachkommen werden", schrieb sie. Ich fühlte mich direkt angesprochen.
All diese Menschen dichteten, alle hinterließen Schriften. Akribisch erforschte Carl diese Hinterlassenschaften und übersetzte sie für mich. So wurde ich hineingezogen in eine aufrüttelnde Welt, in der, für kurze Zeit zumindest, alles nebeneinander existiert hatte, das Fortschrittlichste wie das Konservativste.
Intensive Recherche
Ich wusste: Das ist literarischer Stoff, wie ich ihn nur einmal im Leben vorgelegt bekomme. Ich konnte nicht anders, als mich daran zu versuchen. Tagsüber erarbeitete ich 2015 mit dutzenden Geflüchteten aus dem Globalen Süden ein Stück am Mannheimer Nationaltheater, abends saß ich in meinem Hotelzimmer und begann, mich in die Köpfe meiner Taishō -Protagonist(inn)en einzufühlen.
In den letzten acht Jahren sind Carl und ich ein eingeschweißtes Taishō-Team geworden. Wir ließen nicht mehr davon ab. Phasenweise legte ich das Manuskript beiseite, wenn ich der Erschöpfung nachgeben oder mich mit anderen, dringlicheren Arbeiten beschäftigen musste. Ähnlich wichtig wie das Schreiben ist das ausreichende, teils monatelange Unterbrechen des Schreibens, um Abstand herzustellen und das bislang Geschaffene frisch bewerten und fortführen bzw. verwerfen zu können.
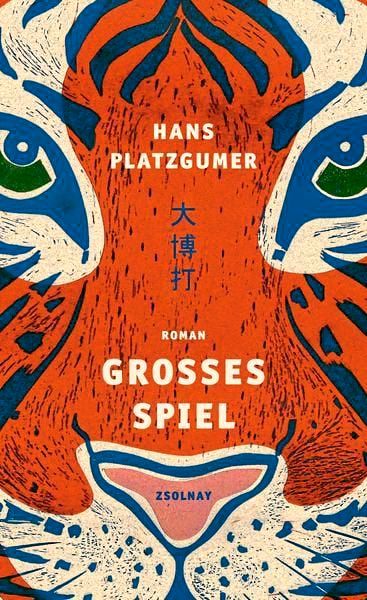
Dieselbe Ungerechtigkeit
Carl und ich spornten uns gegenseitig an. Immer tiefer forschte er den Begebenheiten nach, unermüdlich lieferte er mir Material. Ich formte es in meiner Sprache zu einer Erzählung, die immer vielschichtiger wurde. Ich versank in einer Welt, die alt, fern, exotisch war und doch wie eine Schablone auf die mich umgebende passte.
Die Vorzeichen waren anders, ansonsten hatte sich wenig geändert. Die Ungerechtigkeit war dieselbe geblieben. Gegen sie galt es anzuschreiben. Und auch die Kurzweiligkeit des größten Glücks und die Sinnlosigkeit eines allzu fanatischen Tuns mussten benannt werden.
Erst als im Lauf der Jahre über ein halbes Dutzend unterschiedlicher Fassungen dieses Romans niedergeschrieben und bereits lektoriert worden waren, erkannte ich, wie mich die Taishō-Geschichten an meine eigene Lebensgeschichte erinnerten. Ich hatte als junger Rebell im erzkonservativen Innsbruck mit meinem Vater, der Polizeidirektor war, ähnlich erbitterte Kämpfe geführt. Er sah seine Aufgabe darin, die Ordnung zu bewahren, die Traditionen gegen jede Störung zu verteidigen und die alteingesessene Hierarchie im Land durchzusetzen.
Die Welt, die Krisen
Ich hingegen wollte alles neu definieren, alles beenden, was bis hierher gegolten hatte, nichts bestehen lassen, wie es gewesen war. Ein halbes Leben lang führten wir beide diesen Kampf, erst spät, zu spät vermochten wir, die jeweilige Sturheit und Härte ein Stück weit abzulegen. Erst zwei Hirnblutungen meines Vaters und die Tatsache, dass ich selbst zweifacher Vater geworden war, trugen dazu bei, dass sich die feindselige Beziehung änderte, die er und ich hatten.
Während andere Bücher und Arbeiten von mir abgeschlossen wurden und erschienen, setzte sich der Taishō-Roman nach und nach immer detaillierter zusammen. Außerhalb meines Arbeitsraums veränderte sich die Welt, die Krisen, mit denen die Menschheit konfrontiert war, wurden häufiger, herausfordernder, hartnäckiger, teils unüberwindbarer.
Es mag an diesen Analogien gelegen sein, dass mir mit jedem neuen Schreibdurchlauf die Taishō-Welt plastischer erschien, die Carl mir durch seine Recherchen eröffnet hatte. Aus der Ferne war sie nun ganz nah gerückt. Dutzende Male unternahmen wir das, was wir "japanisches Lektorat" nannten. In unregelmäßigen Abständen legte ich neue Fassungen meiner Verlagslektorin und auch Sandra vor, meiner Frau und häufig Erstleserin.
Der Armeeoffizier
2019 starb schließlich mein Vater, er tat es praktisch in meinen Armen, denn ich war die Person geworden, die ihm gewissermaßen am nächsten stand – auch wenn niemand mehr einschätzen konnte, was und wen er überhaupt wahrnahm. Ähnlich nahe war ich dem Armeeoffizier Amakasu gekommen, einem Nationalisten, Traditionalisten, Monarchisten, der am Ende seines Lebens nicht darum herumkam, sich selbst als Mörder zu bezeichnen.
Ich litt mit ihm mit, seine inneren Kämpfe wurden die meinen. Amakasu war im Zuge der Arbeit zum Ich-Erzähler des Romans aufgestiegen.
Je weiter ihn sein Ringen mit sich selbst führte, je näher die Welt, die er bewohnte, dem Abwurf der Atombombe kam, desto mehr setzte sich in ihm eine niederschmetternde Einsicht durch, von der letztlich kein Mensch je verschont bleibt: Die im Laufe des Lebens begangenen Fehler können höchstens teilweise wiedergutgemacht werden. Nicht für alles kann man sich entschuldigen. Manchmal ist es zu spät dafür.
Carl und ich nutzten die letzten Jahre auch dafür, die Originaltexte unserer Protagonistinnen und Protagonisten musikalisch umzusetzen. Parallel zum Buch ist ein Album entstanden, zehn Songs, die zeitgleich zum Roman erscheinen werden.
Endlosschleife
Nun ist dieser Zeitpunkt gekommen. Am 1. September jährt sich das Kantō -Beben zum hundertsten Mal. Tatsächlich ist das Buch jetzt fertig. Es geht in den Druck. Acht Jahre hat diese Arbeit eingenommen. Die liegende Acht ergibt die Endlosschleife, eine Lemniskate, das Symbol für die Unendlichkeit. Im Japanischen gilt die Zahl 8000 als Sinnbild für das Ewige. "Eure Herrschaft wa¨hre achttausend Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem das Moos sprießt", heißt es in der japanischen Nationalhymne.
Inbrünstig singt Amakasu sie zu Beginn des Romans. Er drückt die Hand aufs Herz und spürt, wie seine gesamte Kompanie, aufgereiht im Hof des Kaiserpalasts, mit ein und derselben Stimme singt. 8000 Generationen. Doch wie die Hoffnung auf die eigene Unfehlbarkeit ist auch die Ewigkeit nichts als ein Trugbild, ein zum Scheitern verdammtes Konstrukt.
Es gibt keine überdauernden Ergebnisse, nur stetige Veränderung. Somit bleibt die eigene Unzulänglichkeit stets bestehen, Amakasus und meine. Nicht zuletzt davon handelt dieses Große Spiel. (Hans Platzgumer, 20.8.2023)