
Die Türkei ist nicht nur die Türkei", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer Rede im Jahr 2016. Als Nachfolgerin des Osmanischen Reichs habe sie die Verantwortung und auch das Recht, sich um alle Länder zu kümmern, die zum einstigen Imperium gehörten. Erdoğan selbst wird ganz konkret. Er nennt den Irak, Syrien, Libyen, die Krim, Montenegro und Bosnien. Staatsnahe Historiker fügen noch Mossul, Kirkuk, Erbil (im Nordirak), Batumi (Georgien), Thessaloniki (Griechenland), Kardzhali und Varna (Bulgarien), Zypern und die griechischen Ägäisinseln hinzu.
Alleinentscheider
Zwar will Erdoğan keine neuen Grenzen ziehen, sondern nur die jeweiligen türkischen Minderheiten und das kulturelle Erbe der Osmanen schützen. Doch erinnert dieser Ansatz fatal an das von Russland als direkte Einflusszone beanspruchte "nahe Ausland", womit auch der Überfall auf die Ukraine legitimiert wird. Erdoğan hat sich bisher denn auch strikt geweigert, diesen Angriffskrieg zu verurteilen. Das alles nennt sich "Erdoğan-Doktrin". Im Konnex damit beansprucht das Konzept "Blaues Vaterland" exklusive Wirtschafts- und Einflusszonen weit in das Schwarze Meer, die Ägäis und das östliche Mittelmeer hinein.
2018, im Jahr nach dem Referendum, wurde in der Türkei ein autoritäres Präsidialsystem eingeführt. Seither entscheidet Erdoğan in allen wichtigen Fragen der Wirtschaft und der Außenpolitik allein. Im Inneren wird die Opposition behindert, Kritiker werden durch eine willfährige Justiz mundtot gemacht, die Medien sind weitgehend gleichgeschaltet; der Islam ist die bestimmende gesellschaftliche und kulturelle Richtschnur.
Neuausrichtung
Die Außenpolitik ist durch ein Abrücken von der Nato (deren Mitglied die Türkei ist), eine Annäherung an Russland, direkte Militärinterventionen in Syrien und Libyen und offensive Diplomatie in Afrika gekennzeichnet. Zugleich befindet sich die Wirtschaft im Sinkflug, die Inflation galoppiert. Die Wiederwahl im vergangenen Mai schaffte Erdoğan entgegen verbreiteten Erwartungen, wenn auch knapp. Laizistisch, demokratisch, prowestlich: Hundert Jahre nach der Gründung der Türkei durch Mustafa Kemal Atatürk sind vom Erbe des "Vaters der Türken" nur noch die äußeren Staatssymbole geblieben.
In ihrem Buch Abschied von Atatürk – Die Krisen und Konflikte der Neuen Türkei zeichnen die deutschen Türkei-Experten Günter Seufert und Christopher Kubaseck die Metamorphose detailreich und mit Tiefgang nach – und enthalten sich klugerweise eines abschließenden Urteils.
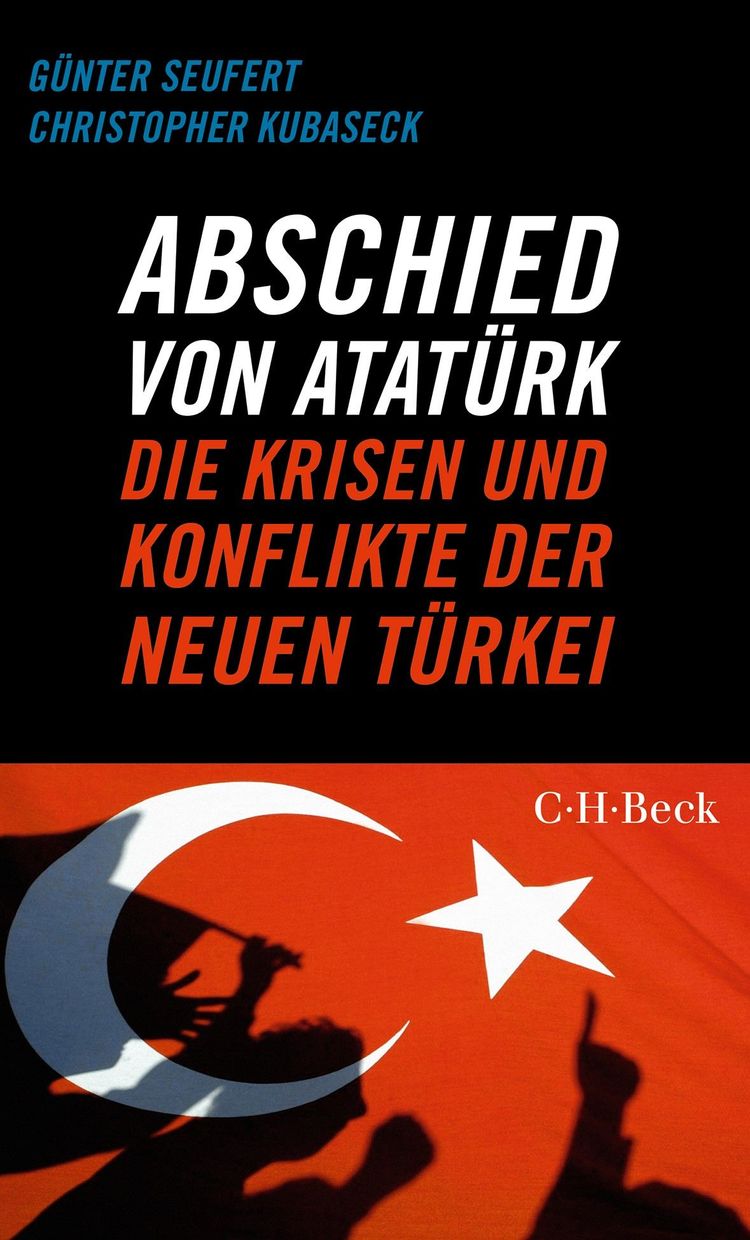
Tiefe Spaltung
Einige wohl für längere Zeit unverrückbare Punkte machen sie gleichwohl fest:
Die türkische Gesellschaft ist tief gespalten in ein säkular-demokratisches und ein islamisch-konservatives Lager; das Militär, einst bestimmender politischer Faktor und Hüter des kemalistischen Erbes, steht seit dem gescheiterten Putschversuch 2016 (dessen Hintergründe noch immer im Dunkeln liegen) unter strikter Kontrolle der Politik; die Abneigung gegen den Westen, vor allem aber gegen die USA, reicht weit in das säkulare Lager hinein. Insgesamt scheint weitgehend Einigkeit darüber zu herrschen, dass der Türkei eine Rolle als selbstbestimmte Regionalmacht zusteht. Das arbeitet Erdoğan in die Hände.
Für die EU bedeutet das ein schier unlösbares Dilemma: Soll sie die Türkei, auf die sie in der Flüchtlingsfrage angewiesen und die weiterhin offiziell Beitrittskandidat ist, als Partner oder bereits als potenziellen Gegner betrachten? Zunächst einmal müsste sie freilich einmal eine gemeinsame Linie gegenüber Ankara finden. Denn die notorische Uneinigkeit der Europäer ist ein weiterer Trumpf für den modernen Sultan, dessen Politik mit Modernität nichts am Hut hat. (Josef Kirchengast, 29.10.2023)