Ein Vulkan bricht aus. Viele Jahre später kehrt Maja an den Ort des Geschehens zurück, nach Japan, wo der Ausbruch des Akita-Komagatake 1970 begann. Eine Eruption, die das Leben der Frau erschütterte, auch weil ihr geliebter Hund Kassawur damals verschwand. Sie beginnt, sich mit Vulkanen zu beschäftigen, auch mit den Auswirkungen von Eruptionen auf Tiere, auf die Natur.

Aber vor allem ist da diese Sehnsucht nach Empathie nach Menschen und Leben. Stattdessen lebt Maja in einer Art Kapsel, die zwischen ihren Mitmenschen und anderen Daseinsformen hindurchschwebt, in einer Art Stille und Einsamkeit: "Damals begann etwas aus mir herauszuwachsen. Es zerbrach die mühsam und akkurat geordneten Regale in mir und alles, was auf ihnen stand. Die alten Orientierungspunkte gab es nicht mehr, und die neuen waren noch zu zerbrechlich, um sich darauf stützen zu können. Ich wusste wohl, dass irgendwo die Wahrheit vergraben lag, die ich unbedingt finden musste."
Das schöne belarussische Wort
Das schöne belarussische Wort "samota" drückt genau diese melancholische Form der Existenz aus, in der Maja gelandet ist. Es ist auch der Titel des Buches von Volha Hapeyeva, dem zweiten Prosaband der belarussischen Autorin, die vor allem als Dichtkraft und Essayistin auch im deutschsprachigen Raum bekannt geworden ist: Samota. Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber.
Die poetische Durchdringung der menschlichen Existenz ist das Feld, auf dem Hapeyeva ihre Lyrik ausspielt. Darum geht es – grob gesagt – auch in ihrem Buch: dem Menschsein in den Zusammenhängen des Großen und Ganzen, der Welt, des Universums und in all seiner Rätselhaftigkeit und Boshaftigkeit auf die Schliche zu kommen, es als etwas mehr begreifen zu wollen als eine mehr oder minder glückliche Fügung von evolutionären DNA-Verkettungen.
Warum in Teufels Namen findet der Mensch nicht seinen Platz in der Welt, der er so magisch entsprungen ist, sondern macht sich seine Umgebung untertan und auch Tiere zu einer kühlen Kosten-Nutzen-Rechnung, zu seiner Beute? Das ist bei Hapeyeva allerdings alles andere als Esoterik, sondern eine hochpoetische und sprachkundliche Erkundung, sogar eine Auflehnung gegen die Empathielosigkeit, die auch in unserer Zeit immer weiter um sich greift.
Eine wirkliche Handlung, die sich Stück für Stück aufbaut und den Leser einem unentrinnbaren Ende zuführt, ist nicht Teil des Konzepts, das Hapeyeva verfolgt. Sie schiebt ihre Figuren durch Zeit und Raum, wirbelt sie durch Situationen, die Erkenntnis und Einsicht zutage fördern sollen. Neben Maja ist da noch die etwas schrullige Helga-Maria. Sie ist möglicherweise nicht real, sondern nur ein metaphysischer Sparringspartner für die nach Erkenntnis suchende Maja. Aber was ist schon real, wenn Realität vor allem aus der eigenen Vorstellung entspringt und der Zugriff auf die Außenwelt, auf andere Menschen immer nur zum Herumirren im eigenen Nebel wird?
Trickreiche Erzählerin
In einer zweiten Ebene entspinnt Hapeyeva die Geschichte von Sebastian, einem jungen Mann, den "der Zusammenhang zwischen der menschlichen Schwermut und der Fähigkeit, Schönheit wahrzunehmen und Mitgefühl zu empfinden", interessiert. Sein Gegenpart ist der grobschlächtige und düstere Jäger Mészáros, der Schlächter der Empathie, wenn man so will.
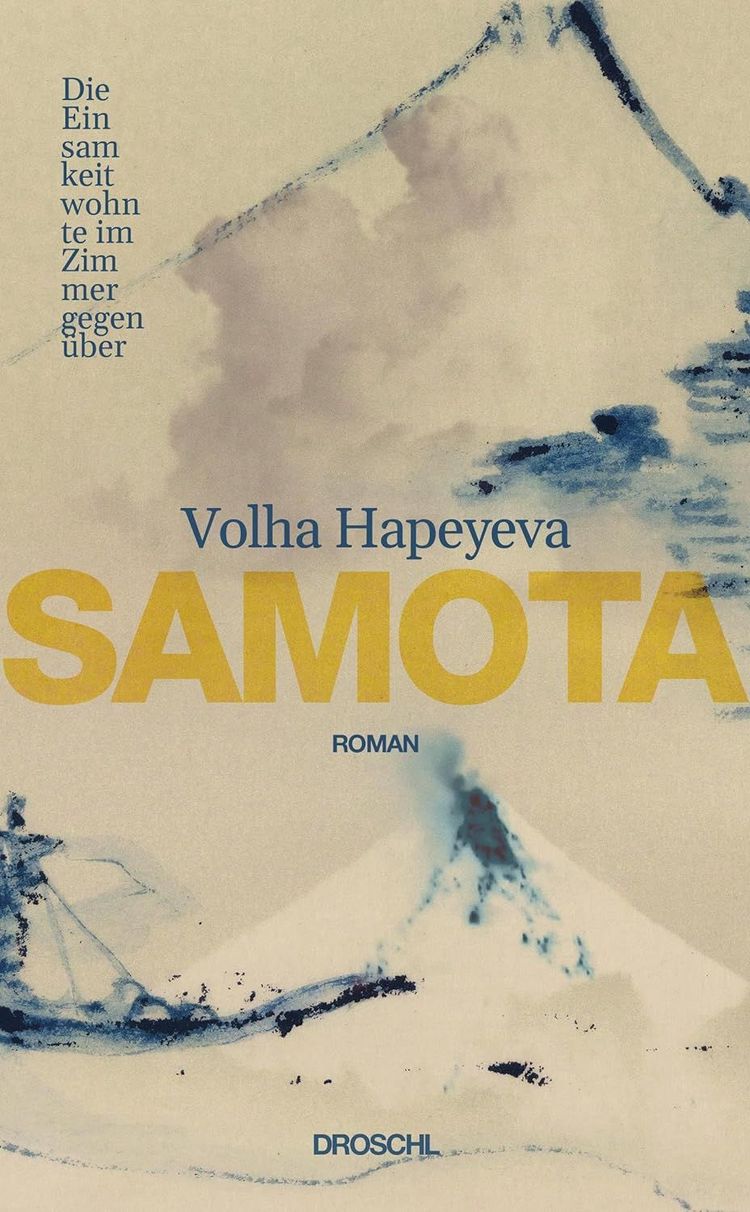
Man hat zunächst den Eindruck, dass sich dieser Teil in einem anderen Jahrhundert abspielt, möglicherweise in einer anderen Dimension, was Hapeyeva auch durch eine Sprache kenntlich macht, die man aus Märchen oder Mythen kennt. Allerdings weiß man auch hier nicht ganz, welcher Fährte man trauen kann, bzw. welcher man letztlich folgen soll. Volha Hapeyeva ist eine trickreiche und kluge Erzählerin, die es versteht, verschiedene Türen aufzustoßen, um Lesenden letztlich zu überlassen, durch welche sie gehen, und um einer möglichen Erkenntnis auf die Schliche zu kommen.
Klare Regeln, literarische Eindeutigkeiten und Verlässlichkeiten gibt es in diesem Buch nicht. Eher ist es eine metapoetische Auslotung universeller Fragen des Menschseins, die vielleicht auch aus der Situation der Autorin herrührt, die eine Wanderin zwischen den Welten ist. Heute als Nomadin, die nicht mehr nach Belarus zurückkann und deswegen von einem neuen Ort zum nächsten muss, noch viel mehr als zu dem Zeitpunkt, als das Buch entstand.
Nämlich 2019 und 2020, als sie Stadtschreiberin in Graz war. In der belarussischen Literaturlandschaft ist sie ohnehin ein Solitär, dessen Verwurzelung im belarussischen Sprach- und Poesiekosmos recht eindeutig ist, der aber immer wieder versucht, diese zu überwinden. Die Dichte an tiefsinnigen Beobachtungen und poetischen Reflexionen – für sich alles kleine Erkenntniswelten – ist der Sog der Empathie, den Hapeyeva in diesem Buch ins Strudeln und Wirbeln bringt.
Samota, von Tina Wünschmann und Matthias Göritz wunderbar ins Deutsche übertragen, verlangt dem Leser also einiges ab. Es ist ein Buch, das denjenigen in höchster Güte belohnt, der das Leben auch im Lesen immer wieder neu lernen will. (Ingo Petz, 31.3.2024)