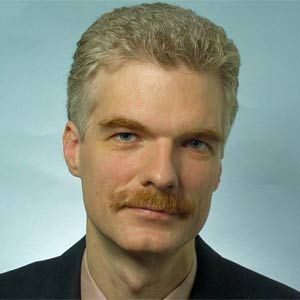
"Niemand würde dort einem Teil der Zehnjährigen sagen, sie sind nicht als Wissensarbeiter geeignet."
STANDARD: Österreich muss einen Absturz beim Lesen auf Platz 31 der 34 OECD-Staaten verkraften. Wie muss darauf reagiert werden?
Schleicher: Ein Land wie Österreich muss sich mit den leistungsstärksten Bildungssystemen messen. Diese ersetzen Detailregulierung durch strategische Zielsetzungen, verknüpfen Lehrpläne, Standards und Rückmeldesysteme wirksam und schaffen Anreiz- und Unterstützungssysteme, die Lehrer motivieren, sich kreativ einzubringen und Verantwortung für Bildungsleistungen zu übernehmen. Sie antworten auf die verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und sozialen Kontexte der Schüler nicht mit institutioneller Fragmentierung und verschiedenen Schulformen, sondern mit einem konstruktiven und individuellen Umgang mit Vielfalt. Schulen sind dort Lernorganisationen, in denen Lehrer voneinander und miteinander lernen, mit einem professionellen Management und einem Arbeitsumfeld, das sich durch mehr Differenzierung im Aufgabenbereich, bessere Karriereaussichten und Entwicklungsperspektiven, die Stärkung von Verbindungen zu anderen Berufsfeldern und mehr Verantwortung für Lernergebnisse auszeichnet.
STANDARD: Der überragende Sieger bei Pisa 2009 ist Pisa-Partner Schanghai. Was sind die Erfolgsfaktoren des dortigen Schulsystems?
Schleicher: Zwei Dinge stehen dort im Mittelpunkt: Die konsequente Ausrichtung aller Bildungsanstrengungen an der Zielvorstellung, dass alle Schüler hohe Bildungsleistungen erzielen können, dass gewöhnliche Schüler außergewöhnliche Fähigkeiten haben, die es zu finden und zu fördern gilt. Dazu zählt die Förderung der Fähigkeit und Motivation jedes einzelnen Schülers. Das erfordert Unterrichtsstrategien, die an die Schüler hohe Erwartungen stellen und sie in Lernprozesse einbinden, die Lehrer und anderes Personal kreativ und flexibel einsetzen, um verschiedene Lernwege und -stile individuell zu unterstützen. Und es gelingt dort, durch Anreizsysteme die fähigsten Lehrer für die schwierigsten Klassen und Schulen zu gewinnen.
STANDARD: In der Analyse der OECD liest man ein relativ klares Plädoyer für eine gemeinsame Schule heraus. Wer zu früh trennt, hat einen starken Einfluss des familiären Hintergrunds, aber keine Leistungszuwächse, ist zu lesen.
Schleicher: In den leistungsstärksten Pisa-Staaten ist es Aufgabe der Schule, konstruktiv und individuell mit Leistungsunterschieden umzugehen, das heißt Schwächen und Benachteiligungen auszugleichen als auch Talente zu finden und zu fördern - und zwar ohne dass die Möglichkeit bestünde, die Verantwortung allein auf die Lernenden zu schieben, also Schüler den Jahrgang wiederholen zu lassen oder sie in Bildungsgänge oder Schulformen mit geringeren Leistungsanforderungen zu transferieren. Eine längere gemeinsame Schule ist in diesen Staaten Selbstverständlichkeit. Dort würde niemand auf die Idee kommen, im Alter von zehn Jahren einem Teil der Kinder zu sagen, dass sie nicht als Wissensarbeiter geeignet sind und sich lieber darauf konzentrieren sollen, für die Wissensarbeiter zu arbeiten.
STANDARD: Österreich zeigt einen sehr großen Einfluss des sozio-ökonomischen Hintergrunds der Familie auf Schülerleistungen. Wie geht es chancengerechter?
Schleicher: In diesen Ländern ist es selbstverständlich, Sorge zu tragen, dass das Potenzial von Schülern aus sozial schwierigerem Umfeld zur Geltung gebracht wird. Dazu reicht es nicht, überall gleichförmige Lernbedingungen zu schaffen, sondern es gilt umgekehrt sicherzustellen, dass Lernbedingungen so flexibilisiert werden, dass Lernerfolg nicht länger vom sozialen Kontext abhängt. (Lisa Nimmervoll/DER STANDARD-Printausgabe, 9.12.2010)