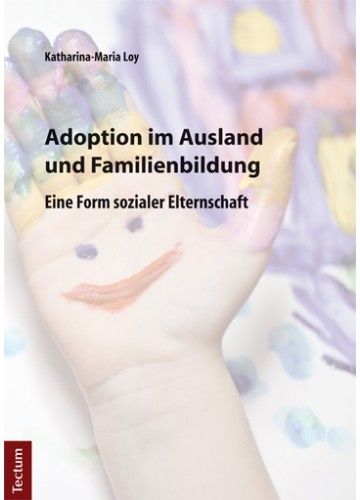DER STANDARD: Frau Loy, Sie arbeiten wissenschaftlich und praktisch zu Erziehungsfragen und unterrichten Kindergartenpädagoginnen. Was bedeutet für Sie Bindung?
Katharina-Maria Loy: Bindung hat viele Dimensionen. Für Mütter kann sie in dem Gefühl bestehen, vom Kind gebraucht zu werden. Kinder sind da wesentlich flexibler. Ich erlebe oft, dass sich Mütter in der Eingewöhnungsphase der Kinder in den Kindergarten wesentlich schwerer von ihren Kindern trennen als die sich von ihnen. Dasselbe gilt bei der Frage der Kinderbetreuung: Die Kinder fragen sich nicht, wer sie betreut, sondern wie sie betreut werden und dass es verlässlich passiert. Wenn ein Kind weiß, dass es nach dem Mittagessen oder nach der Jause vom Vater, von der Mutter, dem Opa oder von wem auch immer abgeholt wird, dann hat Bindung funktioniert. Ab dem Moment, in dem sich das Kind immer wieder fragen muss, ob es abgeholt wird, ist etwas schiefgelaufen.
DER STANDARD: Heißt das, dass Kinder eigentlich zu jedem Menschen Bindung aufbauen können - wenn die Rahmenbedingungen wie Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit stimmen?
Loy: Ja. Wir sehen das bei Adoptivkindern, die als Wunschkinder nach Österreich kommen und hier sehnlichst erwartet werden. Die erleben ganz stark, dass jemand auf sie wartet und für sie da ist. Da funktioniert Bindung.
DER STANDARD: Welche Rolle spielt Verwandtschaft bei der Entstehung von familiärer Bindung zwischen Menschen?
Loy: Ich glaube nicht, dass Bindung mit Blut und Genen zu tun hat. Sondern damit, dass sich ein Kind geborgen fühlt - dass es weiß, dass sich da jemand zuständig fühlt. In vielen Gesellschaften werden Kinder von Männern aufgezogen und nicht von den Müttern, die sie geboren haben. Da spielt auch die Frage, wer mit wem verwandt ist, überhaupt keine Rolle, es ist viel wichtiger, wer mit wem den Alltag verbringt. Da gibt es das festgeschriebene Kleinfamiliensystem gar nicht. Bei uns wird Verwandtschaft massiv gesellschaftlich und sozial überformt. Bei den Familien, die ich untersucht habe, hatte ich übrigens manchmal fast das Gefühl, als würden die Adoptivkinder ihren Adoptiveltern ähnlich sehen. Kinder spiegeln ja Mimik und Gestik der Eltern sehr früh wieder. Dass man als Baby die Mama imitiert, ist auch ein Teil von Bindung.
DER STANDARD: Sie schreiben in Ihrer Studie zu Adoptionen von Kindern aus Südafrika, dass die meisten Menschen am liebsten Säuglinge adoptieren. Weil sie davon ausgehen, dass die noch nicht so stark geprägt sind?
Loy: Ich würde sagen, dass es eine Sehnsucht nach dem ungeprägten Kind gibt. Ein Beispiel: Wenn ein Kind im Kindergarten Schwierigkeiten hat, sagt man bei einem nicht adoptierten Kind in der Regel: Naja, das hatte eben heute einen schlechten Start in den Tag. Wenn das immer wieder vorkommt, denkt man vielleicht, dass da etwas in der Familie nicht stimmt, dass sich die Eltern vielleicht gerade scheiden lassen. Bei Kindern, die adoptiert sind, taucht sehr oft und schnell die Frage auf, ob es sich vielleicht deshalb auf eine bestimmte Weise verhält, weil es Vorerfahrungen gemacht hat. In einer Phase, auf die die jetzigen Eltern keinen Einfluss nehmen konnten. Ist das etwas, was Mutter oder Vater dem Kind mitgegeben haben? Das ist die spannende Frage, weil sie an den Kern geht: Sind es biologische Dinge, die das Kind in sich trägt und die dann als Verhalten heraussprudeln, und man weiß nicht, woher es kommt. Oder ist es die Prägung durch das soziale Gefüge der Familie?
DER STANDARD: Was würden Sie sagen? Was prägt das Verhalten von kleinen Kindern mehr?
Loy: Die sogenannte Anlage-Umwelt-Diskussion beschäftigt die Pädagogik schon lange. Ich denke, dass man weder den einen noch den anderen Faktor isoliert betrachten sollte. Der soziokulturelle Kontext beeinflusst ja nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch unsere Kinder. Wenn sich also gesellschaftliche Normen etwa in Hinblick auf Familienformen ändern, sollte sich de nach auch unser Blick darauf ändern, was Kinder prägt und beeinflusst.
DER STANDARD: Welche Rolle spielt der Geburtsakt für den Bindungsaufbau der Mutter? Bei Adoptivkindern fällt der bekanntlich weg.
Loy: Man geht in der Wissenschaft davon aus, dass für die Mutter die Schwangerschaft und die Geburt die prägendsten Dinge sind, um eine Beziehung zum Kind aufzubauen. Bei Babys sind es dagegen vor allem Zuwendung und Versorgung. Der Vater lernt sein Kind sowieso erst nach der Geburt kennen. Bei den Frauen, mit denen ich für meine Studie gesprochen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie den Geburtsakt vermissen. Bei Adoptionen findet etwas statt, das die norwegische Forscherin Signe Howell die "soziale Geburt" nennt: Es ist der Moment, in dem die Adoptiveltern das erste Mal das Foto des ersehnten Kindes sehen. Viele Eltern beschreiben das als extrem emotional. Da beginnt das Kind für sie, ein Gesicht zu haben. Keine Mutter würde da sagen: Nein, dieses Kind nehme ich jetzt doch nicht.
DER STANDARD: Das heißt, die Adoptivmütter vermissen die Schwangerschaft nicht?
Loy: Die meisten Frauen, mit denen ich gesprochen habe, hätten gerne ein Kind auf die Welt gebracht. Sie wollten aber vor allem wissen, wie das ist, wenn sich ein Kind im eigenen Bauch bewegt. Sie haben das als eine Neugierde beschrieben und nicht als etwas, das ihnen fehlt im Bezug zu ihrem Kind. Eine Mutter hat gesagt, dass man keine Kinder kriegen muss, um eine Familie zu gründen. Eine andere meinte, dass es ihr überhaupt nicht leidtut, nicht schwanger gewesen zu sein: Sie konnte Wein trinken und ausgehen, während sie auf ihr Kind gewartet hat. Es hat ihr nichts ausgemacht, dass sie nicht immer dicker und runder geworden ist.
DER STANDARD: Bei schwarzen Kindern und weißen Eltern ist es für die Umwelt offensichtlich, dass keine direkte Verwandtschaft besteht. Wie gehen Eltern und Kinder damit um?
Loy: In diesen Fällen stellt sich die Frage nicht wirklich. Menschen, die Kinder aus Südafrika adoptieren, sind diesbezüglich sehr reflektiert. Die Erfahrung zeigt: Je offener die Eltern mit der Geschichte der Kinder umgehen und je besser die Kinder informiert sind, desto weniger kommen die Kinder irgendwann in die Situation, zu fragen: Wer bin ich, woher komme ich, was hast du mir vorenthalten? Aus meiner Sicht ist die gesellschaftliche Verantwortung gegenüber diesen Kindern eindeutig: Egal, woher das Kind ist, von wem es ist, ob es leiblich ist oder adoptiert, es muss seinen Platz in der Gesellschaft haben. Das ist ein ganz zentraler Beitrag, damit diese Kinder Bindung und Weltvertrauen entwickeln können. (Lisa Mayr, DER STANDARD, 10./11.5.2014)