Ich weiß es, als wäre es gestern gewesen, wie ich mit Adrian aus diesem Vortrag nach Hause ging." Sagt Serenus Zeitblom, eine Romanfigur Thomas Manns. Versichert somit also der Protagonist eines Buches, Doktor Faustus, über eine andere Romanfigur. Kurz: Wir sind in einem biografischen Erzählwerk. Genregemäß darf sich dieses flexible Freiheiten leisten. Und gönnt sich diese auch, als von einem realen Leben inspirierte Prosa ein Hybrid aus Fakten und Erfindung.
Der Amerikaner Joseph McBride schaffte es, über den maulfaulen wie interviewresistenten Filmregisseur John ("I make Westerns") Ford ein 832 starkes Buch zu verfassen. Dieser Tage erscheint aus seiner Feder nun eine neue Lebensbeschreibung Billy Wilders, 680 Seiten stark. Aber was für ein Unterschied zwischen diesen beiden! Hier der weitgehend mittels Pferderücken, John Wayne und Kavalleristen uramerikanische Mythen kreierende Spross irischer Einwanderer, der zwischen 1917 und 1970 140 Filme drehte, dort der witzige Drehbuchautor, der in seiner zweiten Lebenssprache, dem Englischen, das er lebenslang mit unüberhörbarem Wiener Zungenschlag sprach, funkelnde Screwball Comedies verfasste, bitterkalte Films noirs und Komödien, auf den Regiestuhl wechselte und neben vielen anderem Manche mögen’s heiß realisierte, Das Apartment und Die Frau ohne Gewissen.

Stupend, dass vor dem Engländer Jonathan Coe noch niemand auf die Idee kam, um Billy Wilder (1906–2002) einen Roman herum zu spinnen. Von Coe kam vergangenes Jahr der Zeitroman Middle England heraus, in dem das disparate Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland der letzten zehn Jahren auf dramaturgisch unaufdringliche und zugleich anrührende Weise porträtiert, eingefangen, karikiert wurde und worin zugleich liebevoll an diesem mittelmäßig-moderaten Land gezweifelt und verzweifelt wurde.
Lachen im Scheitern
Leichter, luftiger, ironischer ist Mr. Wilder & ich. Der Roman spielt 1976, als die blutjunge Calista, halb Engländerin, halb Griechin, Wilder kennenlernt und 1977, als sie als Dolmetsch für die in Athen und auf einer griechischen Insel absurrenden Dreharbeiten von Fedora – mit Marthe Keller, Hildegard Knef und William Holden – verpflichtet wird. Nicht ganz zufällig war dies eine recht manieristische Variation von Sunset Boulevard (Boulevard der Dämmerung, 1950). Es war ebenfalls eine Etüde über das Filmbusiness, über Vergessen und künstlerische Stagnation und Resignation. Der nicht übermäßig inspirierten Grundidee gab Wilder dann in der Postproduktionsphase endgültig den Todesstoß, als er in der englischen Version die Stimmen der zwei Hauptdarstellerinnen von einer dritten Aktrice sprechen ließ und in der deutschen Fassung Marthe Keller von Hildegard Knef synchronisieren ließ, sodass die Knef-Stimme zweimal zu hören ist.
Mit leichter Hand lässt Coe Billy Wilder, den Anfangssiebziger, dessen letzter Kinoerfolg schon dreizehn Jahre zurückliegt und der ebenso wie sein engster und langgedienter Kollaborateur, der Drehbuchschreiber I. A. L. Diamond, nicht mehr recht weiß, was im jungen Hollywood ankommt und was nicht beim Kinopublikum, sukzessive sein ganzes Leben entfalten, raffiniert einmal sogar dargeboten in Form eines erzählten Drehbuchs.
Das, was eigentlich eine Tragödie ist, dass 35 Jahre in Hollywood auf hohem, nicht selten höchstem Niveau nicht das Geringste mehr gelten noch zählen, wenn ein vierter und fünfter Flop auf einen dritten folgen, inszeniert Coe als mit Melancholie gesprenkelte Komödie. Um die Balance von Filmkunst, Lebenskunst, Erzählkunst kreist, ohne dies indezent auszuposaunen, dieser feinironische, intelligente Roman.
Stimme der Diva
Maria Callas. Die Callas. Noch heute, fast 45 Jahre nach ihrem Tod am 16. September 1977 in Paris mit gerade einmal 55 Jahren, dürfte sie die bekannteste Primadonna assoluta des 20. Jahrhunderts sein. Zu ihren besten Zeiten konnte sie, der Weltstar, eine Abendgage von 60.000 Euro fordern. Und diese auch bekommen. Sie rückt nun Eva Baronsky, die in einer Kleinstadt nahe Frankfurt am Main lebt und 2009 ihr Debüt veröffentlichte, den erstaunlich erfolgreichen Roman Herr Mozart wacht auf, der 2019 vom Grazer Theater Next Liberty als Jugend-Theaterstück adaptiert wurde, ins Zentrum ihres Romans Die Stimme meiner Mutter.

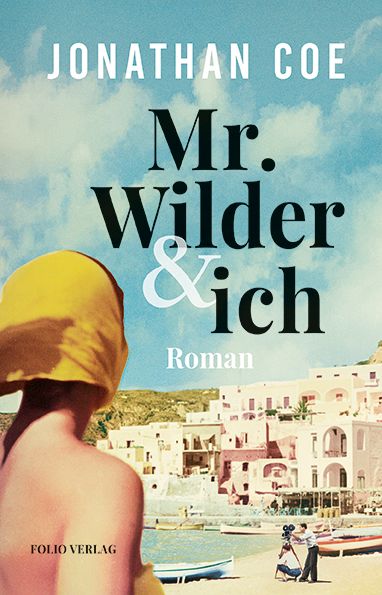
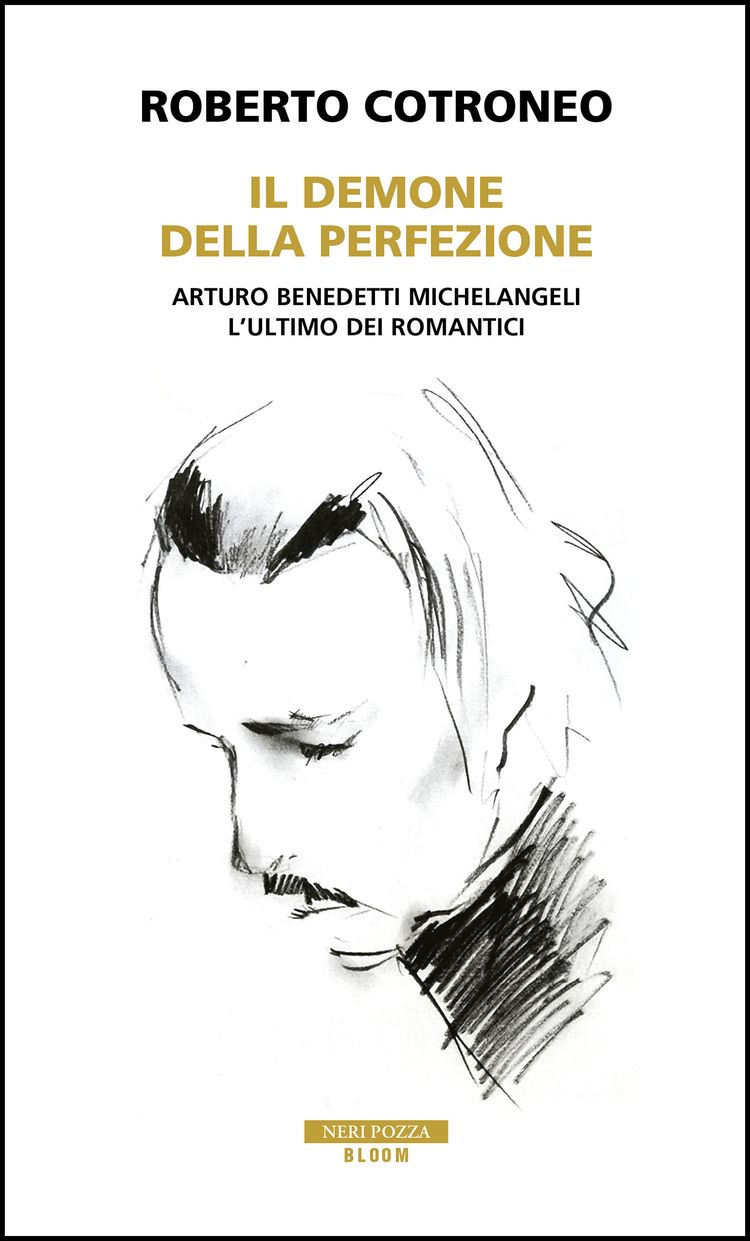
2006 erschien Ricci Tajanis Bild-Dokumentation Maria Callas – The Cruise 59. Biografie einer Reise über die Kreuzfahrt der Callas und ihres viel älteren, ungeliebten Mannes im Sommer 1959 an Bord der Luxusjacht des griechischen Reeders und Milliardärs Aristoteles Onassis, eines Homme à Femmes mit nicht geringen Parvenü-Anwehungen. Das ist auch das Zentrum von Baronskys Roman.
Diese Reise war eine Zäsur für beide, die Callas wie Onassis. In diesen zwei Wochen im Mittelmeer entspinnt sich eine Jahre dauernde Liebesbeziehung. Von dieser erzählt Baronsky einfühlsam wie angenehm, von der Unsicherheit der Sängerin, ihren emotionalen Höhen, Tiefen und Willensentschlüssen – sich von ihrem viel älteren, grantig-undiplomatischen Mann scheiden zu lassen und ihn auch als Manager zu verabschieden –, und vom Wagnis des Aufbruchs in eine neue, große Liebe, die sie bis dahin nicht erlebt hatte.
Dämonische Perfektion
Die Beziehung war von heute aus gesehen ausdauernd und stetig überschattet vom Ende. Im Finale schließlich stellt sich, und das ist nicht nur geschickt, sondern literarhistorisch anspielungsreich, heraus, was es mit dem Titel auf sich hat. Hier hat sich dramaturgisch Baronsky übergroße Freiheit gegönnt. Am Ende der Gesangskarriere der Callas – und das blendet Baronsky recht gnädig aus – war Perfektion für Callas nicht mehr zu erreichen. Was sie unablässig quälte, sekkierte, umtrieb, weil sie den allerhöchsten Grat vollkommener Kunstdarbietung und Kunstausdeutung zuvor touchiert und erlebt hatte.
Roberto Cotroneo, heuer 60 geworden, in Italien viel gelesen, im deutschsprachigen Raum verloren merkwürdigerweise vor rund zehn Jahren die Verlage das Interesse an ihm, hatte, weil auch studierter Pianist, schon immer eine Vorliebe, sich mit Musik literarisch auseinanderzusetzen. Er schrieb über Chopin, Beethoven, die Beatles oder den Jazztrompeter Chet Baker. In Il Demone della perfezione, einem erzählerischen Langessay, halb Umkreisung, halb biografische Nacherzählung, widmet er sich dem Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli (1920–1995), kurz: ABM, einem der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts, Maßstäbe setzender Interpret von Debussy und Chopin, was aktuelle lieferbare umfängliche Boxen und Aufnahmekollektionen der Deutschen Grammophon wie frühe Aufnahmen ab 1939 oder auch eine überwältigende Edition von Live-Mitschnitten von Konzerten in Prag, Mailand, Warschau, in der Vatikanstadt, London und Buenos Aires (bei denen er wiederum Galuppi und Brahms spielte) demonstrieren.
Benedetti Michelangeli, von dem der deutsche Musikkritiker Joachim Kaiser anlässlich eines seiner schon in mittleren Jahren raren Konzerte, 1965 bei den Salzburger Festspielen, enthusiastisch schwärmte, er sei "noch kräftiger und jünger als Artur Rubinstein, noch nobler und stilsicherer als Claudio Arrau, noch rhythmischer und intelligenter als Friedrich Gulda und gewiss technisch so perfekt wie Vladimir Horowitz", musizierte immer wieder auch in Bregenz, den eigenen Flügel im Reisegepäck.
Zugänglich schildert Cotroneo den höchstbegabten sensiblen Italiener aus Brescia, dessen Ambitionen, Einsamkeit, Kälte, Idiosynkrasien, den Widerstreit von Noblesse und Stille zwischen den Noten, den unduldsam mit sich selbst ausgefochtenen Kampf um die absolute, alles überstrahlende, alles in den Schatten stellende Ausdeutung, um das perfekte Spiel, um die Kunst, der das Leben dargebracht wird. (Alexander Kluy, 13.11.2021)