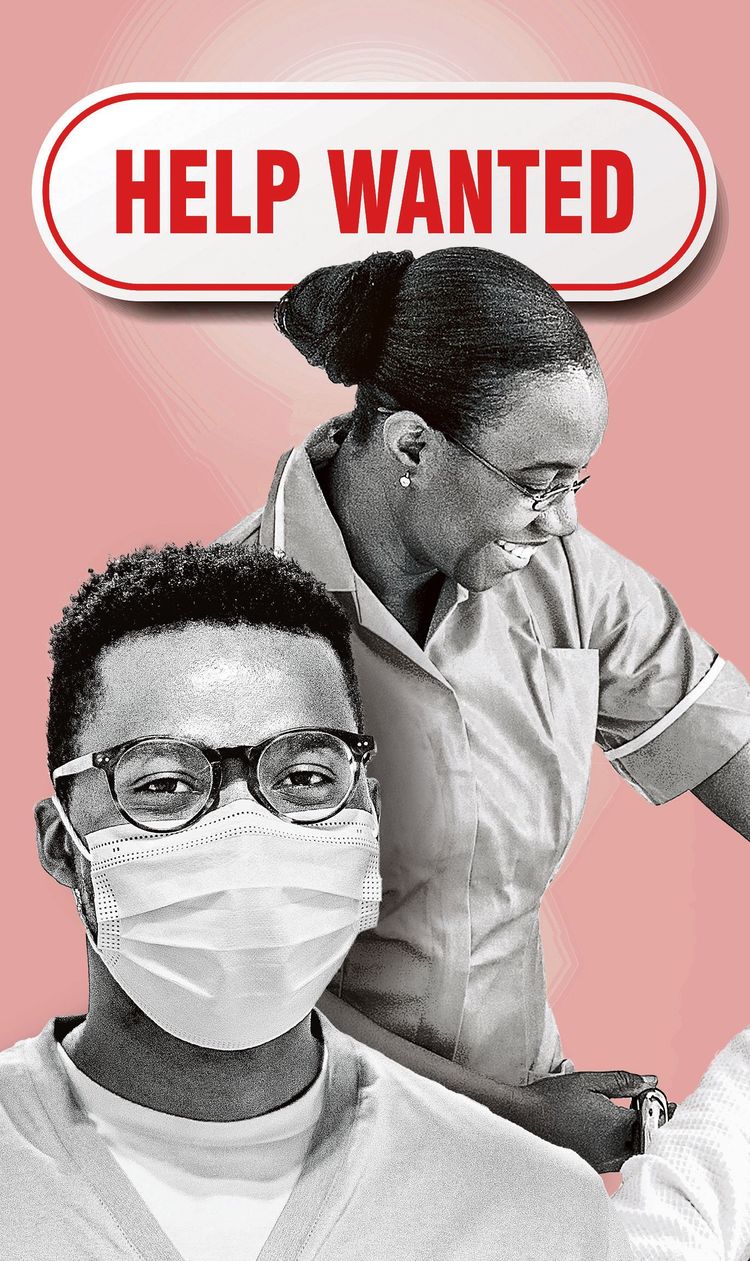
Vom Tourismussektor bis zur Pflege: In Österreich herrscht extremer Arbeitskräftemangel. Die Zahl der offenen Stellen liegt mit rund 200.000 auf Rekordniveau. Der Mangel besteht nicht nur hierzulande, sondern überall in der EU – und wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren in Pension gehen, hinterlassen sie in vielen Berufen und Branchen eine Lücke, die erst recht kaum mehr geschlossen werden kann.
Eine mögliche Lösung sind Arbeitskräfte von außerhalb der Union – also aus sogenannten Drittstaaten. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will in den kommenden beiden Jahren 15.000 von ihnen nach Österreich locken. Die Industriellenvereinigung hält es "für ein Gebot der Stunde, internationale Fachkräfte für Österreich zu gewinnen". Die Stadt Wien will Pflegerinnen und Pfleger von den Philippinen anlocken. Und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer warnte im April, dass "die Konkurrenz nicht schläft", wenn es für Österreich gelte, sich gegen andere Länder im Wettlauf um Arbeitskräfte durchzusetzen.
Aber wie läuft es konkret, wenn Fachkräfte aus Drittstaaten angeworben werden? Auf welche Hürden stößt man, wenn man versucht umzusetzen, was Politik und Wirtschaft wortstark einfordern?
Personalsuche in Kenia
Einblicke liefert ein Projekt der Lebenshilfe, eines Vereins mit rund 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 500 Standorten, der sich für die Interessen von Menschen mit Behinderung einsetzt. Die Lebenshilfe braucht – wie viele andere Institutionen – dringend Pflegerinnen und Pfleger für ihre Einrichtungen. "Wir haben beschlossen, selbst aktiv zu werden", sagt der Tiroler Georg Willeit, Vizepräsident bei der Lebenshilfe.
Und zwar in Kenia. Dort sieht sich Lebenshilfe gerade nach Arbeitskräften um, im Rahmen mehrerer "Fact-Finding-Missions", wie Willeit das nennt. Einerseits erleichtere die Wahl eines englischsprachigen Landes ganz allgemein die Kommunikation. Und, wichtiger: Kenia verfügt über eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Gesundheitssystem, geprägt von Großbritannien, der einstigen Kolonialmacht, sagt Willeit. Deshalb ist vieles von dem, was kenianische Studierende in Sachen Gesundheit lernen, in Österreich anerkannt. Oder sollte es zumindest sein.
Zugleich sind die kenianische Wirtschaft und das Sozialsystem nicht in der Lage, ausreichend Jobs zur Verfügung zu stellen, vor allem für Junge. Die Bevölkerung ist im Durchschnitt 19,5 Jahre alt. Die Jugendarbeitslosigkeit im Land soll – die Zahlen gehen weit auseinander – irgendwo zwischen 13 und 40 Prozent liegen. Eigentlich gute Voraussetzungen also, um Arbeitskräfte zu rekrutieren.
Die Lebenshilfe begann ihr Projekt im Oktober 2022. Auf mehreren Reisen sprachen Vertreter beim Gesundheits-, Außenministerium und Universitäten vor. Eine Projektmitarbeiterin vor Ort wurde angestellt. Es gelang, einen Vorvertrag mit einer Universität in Thika nahe der Hauptstadt Nairobi abzuschließen. Inzwischen steht immerhin fest, dass "40 Pflegefachkräfte im ersten Halbjahr 2024 nach Österreich kommen sollen", sagt Willeit. Gerade lernen sie Deutsch auf B1-Niveau, in Nairobi am Goethe-Institut (siehe Kasten unten).
Stempel von Bezirkshauptmann
In Kenia wird das Projekt breit in den Medien diskutiert. Die Universität in Thika bereite ihre Studierenden "auf Karrieremöglichkeiten in Deutschland und Österreich" vor, vermeldete die Zeitung The Star im August. Der Arbeitskräftemangel in diesen Ländern sei immens, in Österreich etwa würden im Jahr 2030 "ausländische Arbeitskräfte ein Viertel aller Beschäftigten darstellen". Aufgrund dieser Situation sei "die Universität Partnerschaften mit deutschen und österreichischen Institutionen eingegangen, um diese Möglichkeiten zu nutzen".
Für die Lebenshilfe indes beginnt erst der Parcours, der dazu führen soll, dass die Leute tatsächlich ihre Arbeit in Österreich antreten können. Aufenthaltsbewilligung, Arbeitserlaubnis, Visa – es gilt zahlreiche Hürden zu meistern. "Zig Ämter in Österreich werden mit der Angelegenheit befasst sein", sagt Willeit.
Schritt eins, das Visum. Grundsätzlich stellt dessen Erlangung kein Problem dar, zumindest zeitlich befristet – denn Pfleger stehen auf der Mangelberufsliste der türkis-grünen Bundesregierung. Die Anwärterinnen und Anwärter müssen lediglich ihren Arbeitsvertrag mit dem künftigen Dienstgeber, der Lebenshilfe, vorweisen. Allerdings: In der Praxis gestaltet sich die Visaerteilung, die noch in Kenia abläuft, dann doch komplex. Es braucht notariell beglaubigte Übersetzungen von Dokumenten wie der Geburtsurkunde und den Ausbildungszertifikaten. "Das ist teuer und kompliziert", sagt Willeit. Die Lebenshilfe zahlt für das Prozedere, wie es international bei solchen Prozessen üblich ist.
Ist das Visum erteilt, fehlt noch die konkrete Aufenthaltsbewilligung. Die kommt nicht etwa von einer zentralen Behörde in einem Aufwaschen, sondern von der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft des Wohnorts. Die Anwärter müssen also nochmals einzeln dort vorsprechen, mit all ihren beglaubigten Dokumenten, in Begleitung von Lebenshilfe-Vertretern.
Und all das ist noch der leichtere Teil. Der schwierige: die Anerkennung der Ausbildung, die sogenannte Nostrifizierung. Grob erklärt läuft sie so ab, dass die Lehrpläne des Heimatlandes mit jenen in Österreich verglichen werden. Fehlen Teile, müssen in Österreich innerhalb von zwei Jahre Nachprüfungen stattfinden. Je nach deren Erfolg darf man schließlich in Österreich auf unterschiedlichen Stufen der beruflichen Hierarchie arbeiten.
Auch hier droht bürokratisches Dickicht. Denn je nach Ausbildungsgrad sind unterschiedliche Institutionen zuständig. Im konkreten Fall der Pfleger: Wollen die kenianischen Studierenden etwa ihren Pflege-Bachelor aus der Heimat in vollem Umfang nach Österreich mitnehmen, dann ist die Fachhochschule für Gesundheit in Innsbruck für die Nostrifizierung verantwortlich. Es kann aber auch sein, dass sie weniger nachlernen möchten und sich deshalb mit niedrigeren Positionen zufriedengeben, etwa mit der eines Pflege-Fachassistenten: In diesem Fall obliegt die Nostrifizierung den jeweiligen Bundesländern, konkret den Landesgesundheitsdirektionen.
Jahrelanger Prozess
Diese entscheiden dann darüber, ob ein Studierender diesen oder jenen Kurs oder eine bestimmte Anzahl Praktikumsstunden nachzuholen hat. Sind die Abläufe harmonisiert, geht also jedes Bundesland gleich vor? "Ich hoffe es", sagt Willeit, "aber ich weiß es nicht."
Die Studierenden werden in Österreich jedenfalls einiges nachlernen müssen – es gibt Bestandteile der österreichischen Pflegeausbildung, die in Kenia schlicht nicht vorkommen. Das wären vor allem nichtmedizinische Bereiche wie EU-Datenschutz und -Gesundheitsrecht. Außerdem müssen jene Kenianer, die es in der Hierarchie nach oben bis zum Bachelor bringen wollen, ihr Deutsch verbessern, von B1-Niveau auf B2-Niveau. "Wenn all das gelungen ist, folgt auf die befristete die dauerhafte Aufenthaltsbewilligung", sagt Willeit.
Im Übrigen, fügt er hinzu, gebe es auch in der kenianischen Gesundheitsausbildung Aspekte, die wiederum die österreichische nicht kenne. Beispielsweise lernen kenianische Pfleger zu intubieren, österreichische nicht. Doch solche Bereiche sind für das System hierzulande egal. Die Kenianerinnen und Kenianer dürfen die Inhalte, die sie an ihrer Universität in der Heimat gelernt haben, nicht in ihren Beruf in Österreich mitnehmen, wenn das heimische System dies nicht vorsieht.
Fazit all dessen: Es ist ein Prozess, der sich Jahre hinzieht. An mehreren wichtigen Wegmarken entscheiden nicht etwa zentrale Behörden, sondern die Verantwortlichkeiten sind zerspragelt – unterschiedlich nach Wohnort, Bundesland, Ausbildungsgrad. "Wir wissen zwar, dass alle unsere Arbeitswilligen die gleiche Grundausbildung haben, da sie ja an derselben Universität studieren", sagt Willeit, "aber wir wissen nicht genau, ob die zuständigen Ämter dies auch berücksichtigen und immer gleich entscheiden werden."
Wie viele der 40 Studierenden aus Kenia es letztlich wirklich langfristig nach Österreich als Pflegerinnen und Pfleger schaffen werden, bleibt jedenfalls noch eine Zeitlang offen. Genau wie die Frage, ob es angesichts solcher Bedingungen tatsächlich noch viele Tausend weitere Fachkräfte aus Drittstaaten nach Österreich verschlagen wird. (Joseph Gepp, 5.11.2023)