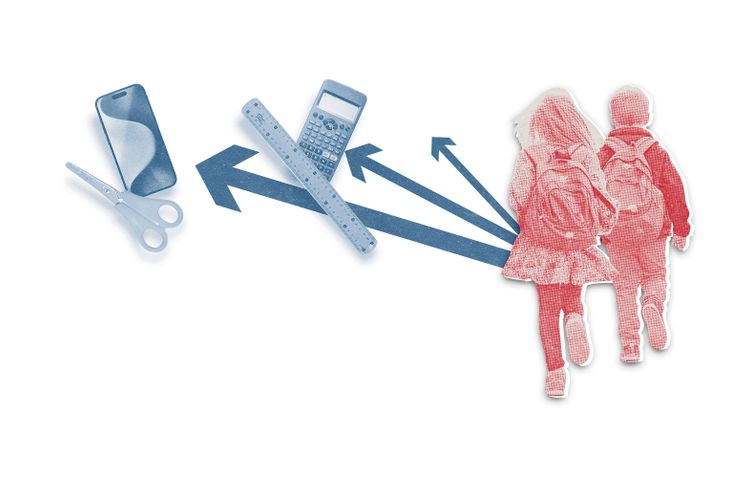
Die Schülerinnen und Schüler in Österreich bekommen in diesen Wochen staffelweise ihre Schulnachricht und treten die Semesterferien an. Einige Eltern warten aber auch auf eine Schulnachricht der besonderen Art: In Wien wird die Bildungsdirektion bis spätestens Mitte Februar den Familien mitteilen, in welche Volksschule ihr Kind ab Herbst gehen kann.
Das ist für Eltern, vor allem in der Bundeshauptstadt, vielfach der Stoff, aus dem ihre Albträume sind. Werden sie in ihre Wunschschule aufgenommen? Oder wollen dort zu viele Kinder aus der Umgebung auch hin? Müssen sie also in die angegebene Zweitschule? Brauchen sie einen "Plan P" wie Privatschule? Können sie sich aus dem öffentlichen Schulsystem mit seinen 233 Standorten herauskaufen in eine der aktuell 78 privaten Volksschulen?
Eltern im Zwiespalt
Tamara* und ihr Mann stellen sich diese Fragen aktuell. Ihr Sohn ist zwar erst in eineinhalb Jahren schulreif, aber die Familie hat heuer bereits eine Volksschule besichtigt. Eine konfessionelle Privatschule. "Sicher ist sicher", sagt die junge Mutter, die ihr Kind eigentlich lieber in eine öffentliche Schule geben möchte. In ihrem Wohnbezirk sei es aber "schwierig, eine zu finden, wo das sprachliche Niveau gut genug ist. Ich unterrichte selbst an einer privaten AHS und sehe da, dass die Kinder alle einen sehr ähnlichen Hintergrund haben, der nicht Wien abbildet. Ich sehe viel Elitedenken, das möchte ich nicht für mein Kind. Er soll die Realität kennenlernen – aber ich möchte auch nicht, dass er in der Schule als deutschsprachiges Kind plötzlich in der Minderheit ist." Um diesen "Zwiespalt" im Interesse des Sohnes gut auflösen zu können, hat die Familie kurzzeitig sogar überlegt, umzuziehen, um einer "öffentlichen Schule mit einem guten Mix an sozialen und kulturellen Hintergründen" räumlich näher zu kommen. Dieser Plan wurde aber verworfen, weil sie sich in der jetzigen Umgebung wohlfühlen. "Eine öffentliche Schule ist aber nach wie vor auf unserer Liste." Im Oktober ist Besichtigungstermin.
Hannah* wiederum hat sich "bewusst für eine städtische Schule entschieden". Ihr Sohn soll in eine Klasse kommen, die so zusammengesetzt ist wie sein Wohnumfeld. Der 16. Bezirk, Ottakring, ist "multikulti" mit hippen Ecken wie dem Yppenplatz und weniger begüterten Straßenzügen mit viel migrantischem Kolorit. Angst, dass ihr Sohn im Sprachengewirr Nachteile haben könnte, hat die Nachhaltigkeitsexpertin nicht, "weil ich ihn unterstützen kann. Sollte er zusätzlichen Förderbedarf haben, werden wir Wege finden, das auszugleichen", ist sie zuversichtlich. Sie wünscht sich auch soziales Lernen mit Diversität und Integrationsklassen. Sollte die Schulzukunft ihres Kindes in der Nummer zwei starten müssen, wäre es auch kein Drama: "Der Weg wäre etwas länger, das Konzept etwas anders, aber die Schule genauso möglich."
Zwei Beispiele, in denen sich die Schmerzpunkte bei der Schuleinschreibung finden. Da es in Wien keine Schulsprengel gibt, bedeutet das: Wenn sich für eine Schule mehr Kinder anmelden, als diese aufnehmen kann, muss umgeschichtet und umverteilt werden, auch auf Schulen, in die (zu) wenige wollen.
Fake-Meldezettel für Schulplatz
Mancherorts spielen sich regelrechte Dramen rund um die Schuleinschreibung ab, Direktorinnen berichteten früher, als die Entscheidung noch am Schulstandort gefällt wurde, über eine Palette von Mitleidsmaschen bis zu Bestechungsversuchen mit goldenen Kulis und anwaltlichen Drohkulissen. Offenkundig nicht in der elterlichen Wohnung gemeldete Kinder kennen viele Lehrerinnen und Lehrer. Ein Schulsozialarbeiter erzählt von "eigenen Plattformen im Internet, auf denen man sich gegen Geld ummelden kann". Denn der Schulweg ist nach bereits eingeschulten Geschwistern am Standort das zweitwichtigste gesetzliche Kriterium, nach dem die Bildungsdirektion die Platzvergabe organisiert.
Laut einer Studie der Ökonomin Anita Zednik von der WU Wien sitzt im Schnitt mindestens ein Kind pro Klasse in besonders gefragten Volksschulen in wohlhabenden Vierteln dank einer manipulierten Wohnadresse dort (DER STANDARD berichtete). Auffällige Um- und Rückmeldemuster vor der Anmeldefrist und nach erfolgreicher Schulplatzzuweisung weisen auf strategisches (und illegales) Elternverhalten hin. Das benachteilige ehrliche Eltern und verstärke soziale Segregation, weil Menschen mit Migrationshintergrund oder weniger Bildung seltener so agieren.
Apropos Segregation. Das ist die wissenschaftliche Beschreibung dessen, was vielen Eltern im Schulkontext Angst macht und was sie möglichst vermeiden wollen: eine Häufung oder Entmischung der Gesellschaft nach bestimmten Kriterien wie Umgangssprache, Bildungsniveau, ethnische Herkunft oder sozioökonomischer Hintergrund. Übrigens wollen auch viele Migrantenfamilien nicht, dass in der Schule ihres Kindes zu viele Kinder sind, die nicht (gut) Deutsch können.
Weniger divers, stärker privilegiert
Wo also gehen die Kinder mit deutscher Umgangssprache und ohne in Wien in die Volksschule? Und welche Rolle spielen Privatschulen in der ersten Schuletappe? Passiert hier Ähnliches wie zum Beispiel in Berlin?
Der Stadtsoziologe Robert Vief von der Humboldt-Universität zu Berlin hat unlängst in einer im Tagesspiegel publizierten Analyse gezeigt, dass die deutsche Hauptstadt immer durchmischter wird, nicht aber die Schulen: "An den Grundschulen sind arme und reiche Kinder immer stärker getrennt." Das gelte für die sprachliche und die soziale Ebene. Vor allem die soziale Diversität in den Kiezen bilde sich in den Schulen nicht ab. Besonders in Privatschulen, deren Anteil zwischen 2006 und 2022/23 von 6,5 auf 10,6 Prozent stieg. Sie sind "sozial weitaus weniger divers und stärker privilegiert als staatliche Einrichtungen – und auch als die Nachbarschaften, in denen sie sich befinden", schreibt der Wissenschafter. Der Anteil armer Schülerinnen und Schüler in Privatschulen ist sehr gering, während die Armutsquote an den meisten öffentlichen Berliner Grundschulen höher ist als in ihren Einzugsgebieten – "mit am Ende negativen Folgen für die Gesamtheit des Bildungssystems".
Wie sieht die Lage in Wien aus? Der Bildungsforscher Christoph Weber von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich hat für den STANDARD analysiert, wie sich die Schulanmeldungen (Vorschule und Volksschule) zwischen 2006 und 2022 je nach Umgangssprache und Bezirk entwickelt und welche Rolle Privatschulen dabei gespielt haben. Ein auffälliger ansteigender Anteil deutschsprachiger Schülerinnen und Schüler, die in eine Privatschule wechseln, wäre ein Hinweis auf einen Segregationsprozess. In der Bildungsforschung wird es auch "Native Flight" genannt, wenn einheimische Eltern quasi einen Abflug aus dem öffentlichen Schulsystem machen, weil ihnen dort zu viele "fremde" oder fremdsprachige Kinder sind.
Die zentralen Aussagen über Wien:
Datenerhebung und Grafik: Michael Matzenberger
Aus dieser Datenlage lassen sich – rein auf die Sprachebene bezogen – für Wien "insgesamt keine Hinweise auf eine Zunahme der Segregation im Kontext von Privatschulen und Herkunft der Schülerinnen und Schüler feststellen", erklärt Christoph Weber.
Weniger deutschsprachige Kinder
Es zeigt sich aber, dass es ein über die Jahre recht stabiles Verteilungsmuster gibt, bei dem bestehende Segregation nach Sozialstatus und Migrationshintergrund plus Wohnsegregation zusammenspielen – und dann als Problemgemengelage in den Schulen landen.
Datenerhebung und Grafik: Michael Matzenberger
Zur Verdeutlichung die Zahlen: 2022/23 besuchten in Wien 78.425 Kinder die Volksschule, 60 Prozent mit nicht deutscher Umgangssprache (das sind fast doppelt so viele wie im Österreich-Schnitt mit 32,8 Prozent). 13,5 Prozent von ihnen gingen in eine private Volksschule (Österreich: 4,9 Prozent), wo Deutschsprachige mit 70,5 Prozent klar dominieren. Anders in den öffentlichen Volksschulen, wo fast drei Viertel (64,7 Prozent) der Kinder eine andere Alltagssprache haben. Als Großstadt hat Wien naturgemäß eine besondere – und besonders herausfordernde – Situation. Aber auch Wels, Linz, Steyr und Graz können hier durchaus mithalten. Bei den Volksschulanfängern ist in Wels der Anteil nicht deutschsprachiger sogar höher als in Wien.
(Noch) kein Run auf Privatschulen
In den Daten bildet sich (noch?) kein Run deutschsprachiger Eltern auf Privatschulen ab, sehr wohl aber zeigen sie immer mehr Kinder mit nicht deutscher Erstsprache, die schulisch versorgt werden müssen. Vor allem im öffentlichen Sektor, sehr unterschiedlich verteilt und mit sehr unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden je nach sozialem und ethnischem Herkunftsmix der Kinder.
Datenerhebung und Grafik: Michael Matzenberger
Anmerkung laut Statistik Austria: In der Grafik ist von Volksschulen die Rede, da sind Schulen mit Organisationsstatut (z.B. ausländische Schulen, Waldorfschulen) nicht enthalten. Darum ist für den 9. Bezirk (Alsergrund) keine Privatschule ausgewiesen, obwohl dort das Lycee Francais angesiedelt ist. Dieses ist auch nicht vom österreichischen Schulrecht umfasst, daher ist das Lycee Francais – im Gegensatz zu anderen ausländischen Schulen wie z.B. die Vienna Internation School und die American International School – nicht in der Schulstatistik inkludiert.
Eine direkte Verknüpfung der Schuleinschreibungs(um)wege eines Kindes mit den sozioökonomischen (Melde-)Daten der Eltern war bis jetzt (noch) nicht möglich und ist technisch sehr aufwendig. Aber Weber, der für den Nationalen Bildungsbericht (NBB) 2015 und 2018 das Ausmaß der sozialen und ethnischen Segregation bezirksweise für Österreich berechnet hat, glich diese Daten nun für Wien mit den Privatschülerzahlen ab – und auch da lasse sich kein klares Muster zum Zusammenhang zwischen dem Anteil der Privatschüler und Segregation erkennen.
Arme lernen mit anderen Armen
Generell gilt, dass ethnische Segregation nach Migrationshintergrund (nicht nur) in Wien eine deutlich geringere Rolle spielt als die nach Sozialstatus. Das heißt: Arme leben und lernen deutlich öfter mit anderen Armen, egal welche Umgangssprache sie sprechen.
So zeigt sich zwar, dass die Bezirke mit der höchsten sozialen Segregation (Währing und Neubau) auch die höchsten Privatschüleranteile haben (53 und 46 Prozent). Dort gibt es eine starke Ungleichverteilung der Schülerinnen und Schüler nach Sozialstatus. Je höher der Segregationswert, umso stärker unterscheiden sich die Schulen im durchschnittlichen Sozialstatus voneinander und desto ähnlicher sind sich die Schüler in der Schule: die gefürchtete "Ballung", die jene, die es können, möglichst meiden wollen. Zusätzlich kann noch interschulische Segregation wirksam werden durch eine ungleiche Zusammensetzung der Klassen mit sozial oder sprachlich "ähnlichen" Kindern ("Restklassen").
Es finden sich aber auch Bezirke mit hohem Privatschüleranteil und vergleichsweise geringer sozialer oder ethnischer Segregation. Die Innere Stadt und Mariahilf etwa, mit einer relativ homogenen Wohnbevölkerung, haben trotzdem mehr als ein Drittel Privatschüler – was an schulischen "Einpendlern" aus anderen Bezirken liegen kann. Und dann gibt es Bezirke mit hoher Segregation und weniger Privatschülern. Dazu gehören Hernals, Ottakring oder Brigittenau, auch deshalb, weil es dort (fast) keine Privatvolksschulen gibt.
Großes Einzugsgebiet der Privaten
Allerdings ist dabei zu bedenken, dass Privatschulen, deren Verfügbarkeit nach Bezirk extrem variiert, in der Regel ein sehr großes Einzugsgebiet haben, das in den Daten nicht nachvollzogen werden kann, weil die Kinder nur dem Schulstandort und nicht dem Wohnort zugeordnet werden können.
Es gibt auch einen frühen Forschungsbefund zu Linz. 2007/08 wurden die Schulsprengel abgeschafft, und Eltern hatten freie Schulwahl – die sozioökonomische und ethnisch-kulturelle Segregation nahm zu, was vor allem durch eine gleichzeitige Zunahme der räumlichen Segregation bedingt war, zeigte die Begleitstudie des Soziologen Johann Bacher von der Uni Linz. Die Schulstandorte waren zudem schon vorher segregiert. Es gab Schulen, an denen mehr als zwei Drittel der Kinder zu Hause nicht Deutsch sprachen, in anderen lag ihr Anteil unter 20 Prozent. "Die Wohnraumsegregation ist als wichtige Komponente für die Zusammensetzung der Schüler/innen in der Volksschule zu sehen, wird aber durch die elterliche Schulwahl verstärkt", heißt es dazu im auch NBB 2015. Höher gebildete Eltern beantragten öfter einen Schulwechsel.
Für Graz zeigte 2015 eine Studie des Soziologen Thomas Sommerer: Wo der Migrantenanteil in der Volksschule deutlich höher war als im Wohnumfeld, sei das "vor allem durch das Abwandern von österreichischen Eltern beziehungsweise ihrer Kinder an eine andere Schule mit zu erklären" – großteils in Privatschulen.
Was bleibt, gilt nicht nur für Wien: Diese Kinder sind nun mal da, sie leben mit ihren Familien in spezifischen Verhältnissen und sprechen daheim immer öfter nicht die Unterrichtssprache Deutsch. Was also tun, um für alle das Beste daraus zu machen? Für Kinder, Eltern und Lehrkräfte, die je nach Standort von immensen Problemen erdrückt werden?
Die Kinder sind nun einmal alle da
Die Bildungsdirektion Wien teilt dazu mit, dass sie alles daransetze, den Wunschschulplatz zuzuteilen, "was in neun von zehn Fällen auch gelingt". Soziale Kriterien könnten für die Platzvergabe nicht herangezogen werden, da sie gesetzlich nicht vorgesehen seien und die Behörde auch keine personenbezogenen Daten über die sozialen Hintergründe der Kinder habe. "Eine Zwangszuweisung zur Herstellung von sozialem Ausgleich ist aufgrund der regionalen Verteilung nicht möglich und würde nur zu einer verstärkten Abwanderung in den Privatschulsektor führen."
Einen Weg, mit multiplen Segregationseffekten in Schulen umzugehen, hat Bildungsforscher Bacher 2010 (gemeinsam mit Herbert Altrichter und Gertrud Nagy) aufgezeigt: mit einem Modell für eine indexbasierte Finanzierung. Das hieße, sagt er zum STANDARD: "Wir akzeptieren Segregation in einem bestimmten Ausmaß, aber geben den Schulen mehr Mittel." Man könne räumliche Segregation durch Wohnpolitik reduzieren, "aber es wird trotzdem noch Segregation bleiben".
Also direkt auf den spezifischen Problemmix einer Schule eingehen. Aktuell läuft dazu ein Pilotprojekt der Regierung, das 100 besonders belastete Volks- und Mittelschulen mit 15 Millionen Euro gezielt unterstützt. "Endlich, die Politik muss Schulen wie unserer Ressourcen zur Verfügung stellen, über die wir autonom entscheiden können", sagt eine beteiligte Direktorin*, die im Schulhaus 30 Sprachen hört: "Es ist alles machbar, wenn wir andere Vorteile bekommen. Dazu gehört auch mehr Gehalt für die Lehrkräfte in belasteten Schulen. Dann ist es auch völlig egal, ob hier 80 Prozent Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sind." Ach ja, noch was: "In Privatschulen läuft auch nicht alles immer besser. Ich habe einige ,Rückläufer‘, weil sie dort halt nicht dazupassen." Plötzlich sind sie wieder zurück. In der öffentlichen Schule. Und dann? (Lisa Nimmervoll, 10.2.2024)
* Die Namen wurden auf Wunsch der Gesprächspartnerinnen geändert oder anonymisiert.