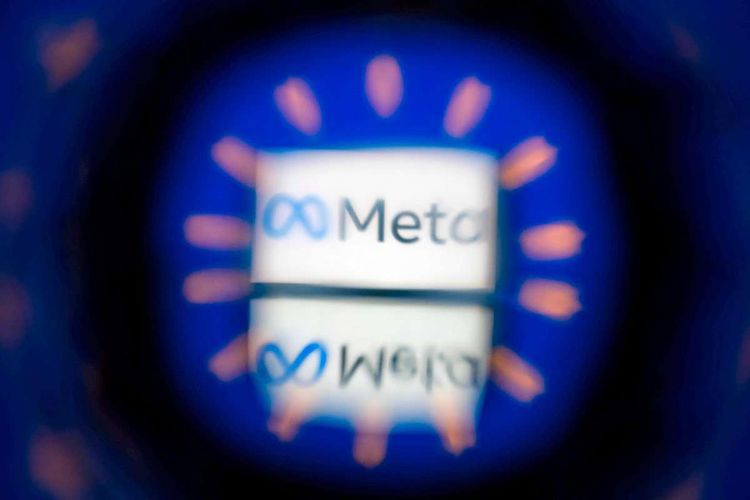
Ein Grundpfeiler des Digital Services Act ist bekanntlich der Zugang der Forschung zu den Daten der großen Onlineplattformen, genannt VLOPS (Very Large Online Platforms). Forscherteams haben jetzt laut EU-Recht die Möglichkeit, tiefen Einblick in die Daten von Facebook, X, Instagram, Tiktok und Co zu erhalten. Warum liest man aber nicht täglich von aufgespürten Propagandanetzwerken oder süchtig machende Algorithmen? Ganz einfach: weil der hehre Ansatz in der Praxis nicht wirklich funktioniert.
Probleme für Forschungsteams
Dabei war die Grundidee gut: Die EU-Kommission ist die Wächterin darüber, ob die Online-Riesen die Anforderungen des DSA auch umsetzen und etwa wirksame Inhaltmoderationssysteme installiert haben. Aber, aufgrund der Fülle an Informationen ist die Kommission auf Daten aus der Wissenschaft oder von zivilgesellschaftlichen Organisationen angewiesen, die sie beschaffen und auswerten. Das zu tun erlaubt der DSA ausdrücklich. Wer zu einem Risiko durch große Onlineplattformen forscht, der erhält auch Zugang zu den Daten.
Doch hier fangen die Probleme schon an, wie Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung bei einer Infoveranstaltung der RTR in Wien erklärt. Jaursch ist Projektleiter bei der Berliner NGO und dort unter anderem für den Bereich Plattformregulierung zuständig.

Die Probleme würden schon bei der Frage beginnen, wer eigentlich als "Forscher" gilt. Zwar deuten die Anzeichen darauf hin, dass auch Organisationen außerhalb des universitären Bereichs als sogenannte "überprüfte Forscher" Daten von den Online-Riesen anfordern dürfen, aber genau geregelt ist das nicht. Das liegt unter anderem daran, dass Forscherteams nachweisen müssen, dass sie unabhängig agieren, was ebenfalls ziemlich schwammig formuliert ist. "Wie weißt man nach, dass man finanziell unabhängig ist?", fragt Jaursch.
Im Reglement zur Forschung an Plattformdaten versteckt sich auch noch ein weiteres Schlupfloch, das die VLOPs zu ihren Gunsten auslegen können, um sich vor einer Herausgabe der Daten zu drücken. Denn der DSA sieht vor, dass die Geschäftsgeheimnisse der Plattformen gewahrt werden müssen, was an sich nachvollziehbar ist. Aber: Mit der Berufung auf Geschäftsgeheimnisse ist es für die Plattformen sehr einfach, die Daten nicht herauszurücken. "Plattformen könnten das als Ausrede nutzen", so Jaursch.
Wer ist zuständig?
Damit hören die Probleme für die Forschenden aber noch nicht auf. Sie müssen einen Antrag beim Digital Service Coordinator des jeweiligen Landes stellen. Diese leitete den Antrag anschließend an die zuständige Behörde jenes Lands weiter, in der die Plattform ihren Europa-Sitz hat. Im Fall von Google, Apple, Tiktok (Bytedance), Shein, Meta, Microsoft, Pinterest und X ist das Irland.
Will also ein Team aus Österreich Daten von Tiktok, dann stellt es einen Antrag bei der RTR / Komm Austria, woraufhin diese das Ansuchen an die irische Behörde weitergibt. Das Problem: Nur weil ein Antrag auf Dateneinsicht in Österreich rechtlich möglich wäre, heißt das nicht, dass dem in Irland auch so ist. Wie das in der Praxis funktioniert, ist unklar.
Hürden über Hürden
Ist der Antrag aber erfolgreich, stehen Forscherteams schon vor der nächsten Hürde. Denn im DSA ist nämlich nirgendwo festgeschrieben, dass die Plattformen die Daten für die Forschung kostenlos bereitstellen müssen, was ein enormes Problem für die Wissenschaft darstellt, wie der Experte erläutert.
Ungeregelt ist auch, wie die Daten bereitgestellt werden. So sei es möglich, eine CSV-Datei zu erhalten oder Zugriff auf die API, also die Programmierschnittstelle der Plattformen, zu bekommen. Im Vorfeld wisse man oft nicht, ob die übermittelten Daten überhaupt maschinell lesbar seien, so Jaursch. Unklar sei auch, was als Datenpunkt gelte – so sei etwa fraglich, ob Interviews dazugehören.
Viele offene Fragen blieben also für die Forschung, deshalb müsse der Digital Services Act nachgebessert werden. Ist das Regelwerk also ein Fehlschlag? Jaursch widerspricht, der Ansatz des DSA sei auf jeden Fall vielversprechend, und ein verpflichtender Datenzugang sei wichtig, auch wenn er aktuell nur in der Theorie funktioniere. Jaursch geht davon aus, dass bis Ende des Jahres nachgeschärft wird. Die Forschung könne somit ab Anfang 2025 die Daten der Onlinenetzwerke auswerten. Bis dahin heißt es: Bitte warten! (Peter Zellinger, 22.5.2024)