Die für die SPÖ erreichbaren Wählerinnen und Wähler sind links-progressiver als gedacht, erläutert Politikwissenschafter Eric Miklin in seinem Gastkommentar.
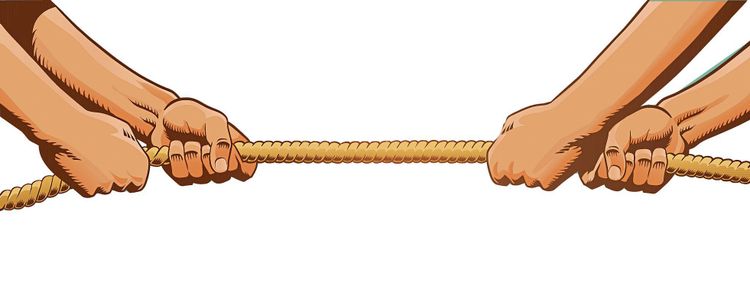
Mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler stehen am Samstag beim SPÖ-Parteitag zwei Kandidaten zur Wahl, die sich abseits rhetorisch grundverschiedener Zugänge von Marxismus bis EU in ökonomischen Fragen substanziell letztendlich kaum unterscheiden. Bei der Migrationsfrage stehen beide jedoch fast prototypisch für grundverschiedene Ansätze. Während Doskozil schon unter Christian Kern den Kurs der Bundespartei als "links-grüne Fundipolitik" kritisierte und für eine deutliche Annäherung an FPÖ- und ÖVP-Positionen eintritt, lehnt Babler dies strikt ab und fordert stattdessen eine klare progressive Gegenstrategie.
In der medialen Diskussion wird das "Modell Doskozil" meist als erfolgversprechender gesehen: Nur so könne die SPÖ Wählerinnen und Wähler rechts der Mitte (zurück)gewinnen. Und selbst wenn links dadurch Stimmen an Grüne oder KPÖ verloren gingen, wäre in Summe eine Mehrheit gegen Blau-Schwarz so immer noch wahrscheinlicher. Begründet wird dies meist mit Doskozils Erfolgen im Burgenland, dem vermeintlichen Erfolg der Neuausrichtung der dänischen Sozialdemokratie sowie durch Umfragen, denen zufolge Doskozil bei FPÖ- und ÖVP-Wählerinnen und Wählern beliebter ist (siehe dazu auch David M. Wineroithers Gastkommentar "Weiter nur die Oppositionsgeige für die SPÖ?", 30. 5.).
Zwei Haken
Diese Sicht hat allerdings zwei Haken. Erstens ist keineswegs sicher, dass der dänische oder burgenländische Weg auch in Österreich erfolgreich wäre. Zweitens bedeutet eine bei rechten Wählerinnen und Wählern größere Beliebtheit nicht automatisch, dass diese auch tatsächlich Doskozil statt FPÖ-Chef Herbert Kickl wählen würden. Betrachtet man die Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher Forschung zu diesem Thema, spricht dafür tatsächlich wenig. Und noch weniger spricht dafür, dass die SPÖ einen solchen Kurs intern überhaupt durchhalten könnte.
Wie bereits Silja Häusermann und Tarik Abou-Chadi an dieser Stelle dargelegt haben, ist das elektorale Potenzial für eine klar links-progressive Sozialdemokratie europaweit durchaus größer als angenommen (siehe "Das vermeintliche linke Dilemma", 14. 3.). In einer neuen Studie haben sie nun die Beliebtheit von vier sozialdemokratischen Ausrichtungen in Österreich und fünf weiteren Staaten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass das "Modell Doskozil", also eine ökonomisch linke, in Umwelt- und Gleichberechtigungs- und vor allem Migrationsfragen jedoch eher konservative Ausrichtung insgesamt tatsächlich am beliebtesten ist. Betrachtet man jedoch nur Personen, die realistisch überhaupt als Wählerinnen und Wähler sozialdemokratischer Parteien infrage kommen, dreht sich das Bild. Denn außer in Dänemark (!) landet die links-konservative Ausrichtung dann in allen Ländern klar hinter einer klassisch sozialdemokratischen sowie einer links-progressiven Ausrichtung nur auf Platz drei. Lediglich die vierte, sowohl ökonomisch wie gesellschaftspolitisch moderate Variante ist noch unbeliebter. Und in Österreich "gewinnt" überhaupt die links-progressive Variante.
"Mindestens so wichtig wie die Position selbst ist, dass Parteien diese auch geschlossen und konsequent vertreten."
Zudem zeigt sich, dass zwar eine klassisch sozialdemokratische oder links-progressive Ausrichtung die Wahlwahrscheinlichkeit im Vergleich zu linken beziehungsweise grünen Parteien jeweils signifikant erhöht. Eine links-konservative oder gesamt moderate Ausrichtung hätte jedoch kaum Auswirkungen auf die Wahlwahrscheinlichkeit gegenüber rechtspopulistischen beziehungsweise Mitte-rechts-Parteien. Im Einklang mit früheren Studien ohne Österreich-Bezug sprechen die Ergebnisse also klar dafür, dass eine in Migrationsfragen restriktive (wie auch eine insgesamt moderate) Ausrichtung der SPÖ zwar zum Verlust linker, aber kaum zum Gewinn rechter Wählerinnen und Wähler führen würde.
Interne Konflikte
Und selbst wenn es umgekehrt wäre, wäre das keine Garantie, dass die SPÖ mit dem von Doskozil geforderten Kurs erfolgreicher wäre. Denn mindestens so wichtig wie die Position selbst ist, dass Parteien diese auch geschlossen und konsequent vertreten. Erstens, weil Wählerinnen und Wähler diese dann teilweise selbst übernehmen. Zweitens erhöht dies die wahrgenommene Glaubwürdigkeit und Kompetenz der Partei und so ihre Chancen in der (für die SPÖ entscheidenden, weil realistisch erreichbaren) Mitte. Drittens sind, wie die SPÖ selbst nur zu gut weiß, interne Konflikte ein gefundenes Fressen für andere Parteien und Medien und erschweren so, eigene Kernthemen effektiv zu platzieren.
Nachdem bei der Mitgliederbefragung fast zwei Drittel der Stimmen auf Babler und die (in Migrationsfragen zumindest moderate) bisherige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner entfielen, ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass die von Doskozil geforderte Neuausrichtung nicht wiederum heftige interne Konflikte hervorrufen würde. Tatsächlich könnte genau das für Doskozil ein strategisches Dilemma werden: Setzt er sich intern durch, hat er große Teile der Partei gegen sich. Setzt er sich aber nicht durch, würden FPÖ und ÖVP ihm das wohl freudig unter die Nase reiben. Umgekehrt zeigt aber die Unterstützung vieler Landesorganisationen für Doskozil, dass wohl auch eine zu progressive Positionierung intern problematisch wäre. Dies umso mehr als, wie wiederum eine Studie zeigt, die föderale Struktur der SPÖ es (anders als in Dänemark) de facto unmöglich macht, öffentliche Kritik durch (angedrohte) Sanktionen zu unterbinden.
Glaubwürdige Position
Wer auch immer am Samstag gewinnt und das Stimmenpotenzial bei kommenden Wahlen voll ausschöpfen will, wird daher wohl nicht umhinkommen, nach 30 Jahren endlich eine glaubwürdige Position zu erarbeiten, mit der einerseits die (linke) Parteibasis leben kann, die aber andererseits auch genügend Spielraum bietet, auf regional unterschiedliche Interessen reagieren zu können, ohne dass man sich gegenseitig sofort als "links-grüne Fundis" oder "drittbeste Ausländerhasser" die Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Familie in Abrede stellt. (Eric Miklin, 2.6.2023)